Die CDs der Woche - 2025:
Für KW 51: Zum Jahresabschluss gibt es kaum noch neue CDs,
deswegen ein Rückblick auf ein bislang hier noch nicht
erwähntes 2025er Highlight:
Dave Kerzner: Sonic Elements - IT (A Celebration of The Lamb Lies Down on Broadway)
Dass man den alten Genesis-Klassikern durchaus noch neue Seiten
hinzufügen kann, hatte es Steve Hackett Anfang des Jahres in Bremen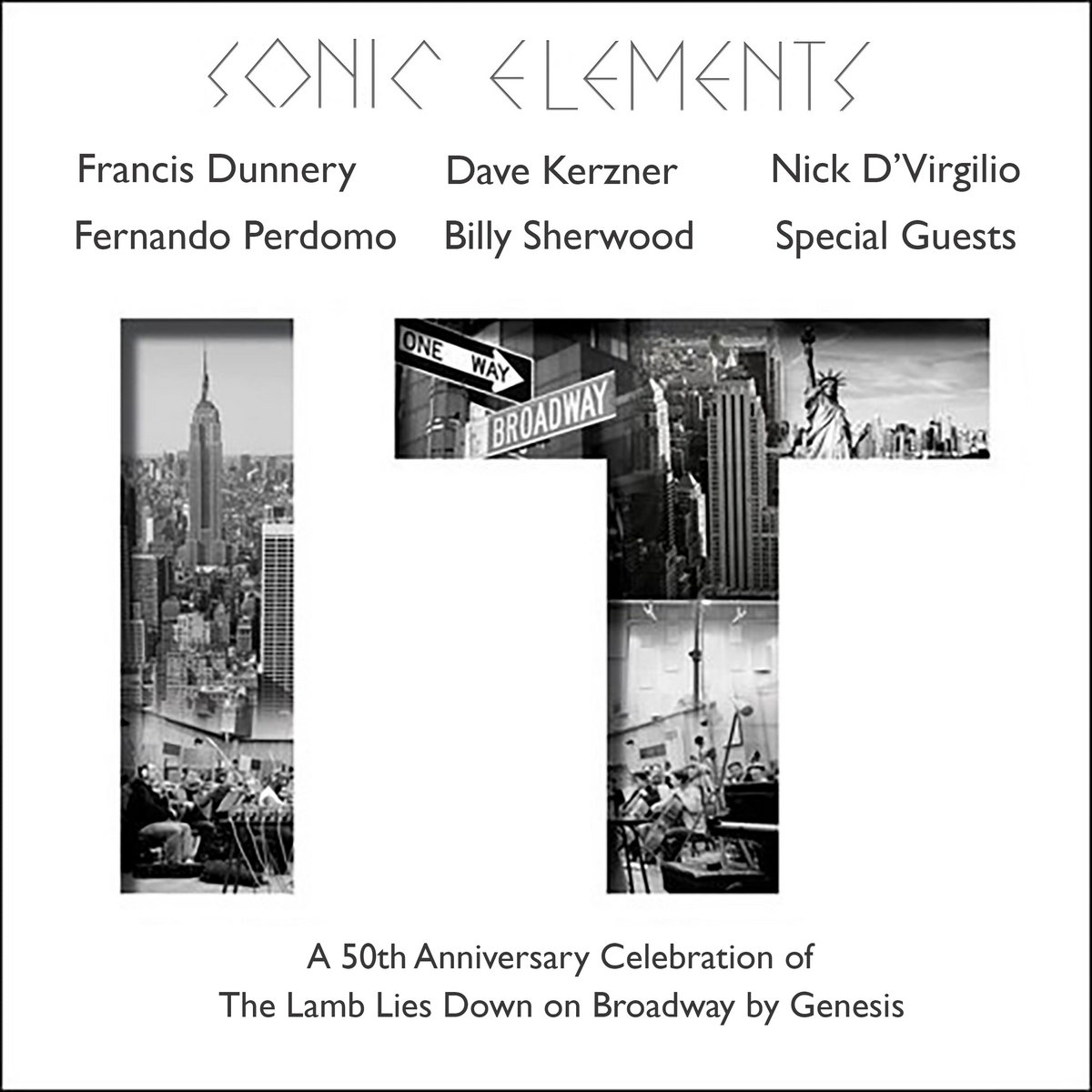 sowie auf seiner
aktuellen Live CD (siehe unten, KW 7) bewiesen. Ähnliches macht
Dave Kerzner jetzt auch, und er geht dabei sogar noch ein ganzes
Stück weiter! Er hat sich das Genesis-Album "Lamb Lies Down"
vorgenommen, und verpasst ihm passenderweise zum 50. Geburtstag einen
Neuanstrich. Das beginnt mit dem neuen neuen, klassischen Intro sowie
diversen weiteren symphonischen Orchestereinlagen und geht weiter
über diverse kleine Spielereien und große Soli. Kirsche auf
dem Eis ist der Gesang: den übernimmt nämlich It Bites
(Original-)Sänger Francis Dunnery! Eine mega Performance aller
Beteiligten, darunter u.a. Nick D’Virgilio (Big Big Train,
Genesis) und Martin Levac (The Musical Box) am Schlagzeug, Billy
Sherwood (Yes), Steve Rothery (Marillion), Lee Pomeroy (ELO, It Bites),
Dan Hancock (Giraffe) sowie weitere Gastmusiker und ein
Sinfonieorchester, aufgenommen von Mark Hornsby und arrangiert von John
Hinchey. Die Songs entfalten teilweise eine ganz neue Wirkung, ohne das
Original wirklich groß zu verändern. Wahnsinn. Unbedingte
Hörempfehlung!
sowie auf seiner
aktuellen Live CD (siehe unten, KW 7) bewiesen. Ähnliches macht
Dave Kerzner jetzt auch, und er geht dabei sogar noch ein ganzes
Stück weiter! Er hat sich das Genesis-Album "Lamb Lies Down"
vorgenommen, und verpasst ihm passenderweise zum 50. Geburtstag einen
Neuanstrich. Das beginnt mit dem neuen neuen, klassischen Intro sowie
diversen weiteren symphonischen Orchestereinlagen und geht weiter
über diverse kleine Spielereien und große Soli. Kirsche auf
dem Eis ist der Gesang: den übernimmt nämlich It Bites
(Original-)Sänger Francis Dunnery! Eine mega Performance aller
Beteiligten, darunter u.a. Nick D’Virgilio (Big Big Train,
Genesis) und Martin Levac (The Musical Box) am Schlagzeug, Billy
Sherwood (Yes), Steve Rothery (Marillion), Lee Pomeroy (ELO, It Bites),
Dan Hancock (Giraffe) sowie weitere Gastmusiker und ein
Sinfonieorchester, aufgenommen von Mark Hornsby und arrangiert von John
Hinchey. Die Songs entfalten teilweise eine ganz neue Wirkung, ohne das
Original wirklich groß zu verändern. Wahnsinn. Unbedingte
Hörempfehlung!
Für KW 50: The Pineapple Thief - Retracing Our Steps: 8-Disc-Box, (Kscope)
Nicht kleckern; klotzen! Was Springsteen kann, kann Sword schon
lange: wie der Boss, der mal eben sieben unveröffentlichte Alben
raushaut (s.u., KW 26), kommt auch Bruce Soord kurz vor Weihnachten
noch mal mit einem ganz besonderen Paket. Wobei man hier dazu sagen
muss, dass die sieben CDs nicht alle unveröffentlicht sind, aber
mit einer Phase aus der Zeit 2007-17 aus einer Dekade stammen, in der
The Pineapple Thief noch nicht ganz den Bekanntheitsstatus hatten, den
sie heute haben, bzw. gerade in der Übergangsphase dahin waren,
Epen für die Ewigkeit zu schreiben. Erst mit dem ersten Album NACH
dieser Zeit stieg Porcupine Tree Drummer Gavin Harrison ein und verhalf
den Alben auf eine weitere neue Dimension. Was die Qualität der
hier vorliegenden Alben aber unnötig abwertet. Denn auch hier gab
es bereits und bekommen wir hier fantastische Musik, die es dringend
wert ist, noch einmal remixed and remastered beleuchtet zu werden.
 Das
beginnt schon mit CD1 „What We Have Sown“ (2007), die auf
mehr als 70 Minuten neben dem mitreißenden Opener „All You
Need To Know“ und drei Bonustracks u.a. das fast 28minütge
Titelstück aufweist. Auch „Tightly Unwound“, 2008 von
Soord komplett in Eigenregie eingespielt und aufgenommen, bringt es auf
60 Minuten. Songs wie „Shoot First“ oder das
11minütige „Different World“ besitzen schon das
PT-typische Flair aus Rocksong-Vibe und flächigen Keyboards, aus
Melancholie, Spannung und Unvorhersehbarem. Wunderbar!
Das
beginnt schon mit CD1 „What We Have Sown“ (2007), die auf
mehr als 70 Minuten neben dem mitreißenden Opener „All You
Need To Know“ und drei Bonustracks u.a. das fast 28minütge
Titelstück aufweist. Auch „Tightly Unwound“, 2008 von
Soord komplett in Eigenregie eingespielt und aufgenommen, bringt es auf
60 Minuten. Songs wie „Shoot First“ oder das
11minütige „Different World“ besitzen schon das
PT-typische Flair aus Rocksong-Vibe und flächigen Keyboards, aus
Melancholie, Spannung und Unvorhersehbarem. Wunderbar!
Die 2009er EPs The Dawn Raids (Vol 1 & 2) wurden mit weiteren
Raritäten ergänzt zu einer weiteren Stunde Spielzeit.
Das 2010er „Someone Here Is Missing“ hat mich seinerzeit
total begeistert, hier fällt es im direkten Vergleich etwas ab. Es
ist ein wenig moderner, experimenteller, bisweilen ein wenig mehr Pop,
hier und da mit etwas schärferer Kante – kein unbedingtes
Highlight, aber ein Aufbruch zu neuen Ufern. Und mit dem
Titelstück, „3000 Days“, seinerzeit auch Namensgeber
für die erste Best-of Kopplung der Band, sowie „So we
Row“ gibt es durchaus auch echte Perlen. Zudem gibt es hier
noch Bonusmaterial, wie u.a. die Songs der „Show A Little
Love“ EP.
Spätestens mit dem 2012er „All the Wars“ beginnt die
Phase der überwältigenden Alben. Größer,
mächtiger, aufwändiger ist das Motto, Abwechslungsreichtum
inklusive synfonischer Elemente treffen auf extrem starkes Songwriting
schwächere Songs braucht man hier eigentlich auch nicht mehr zu
suchen. Für die Tournee des 2014er „Magnolia“ kam
schließlich Gavin Harrison dazu und Steven Wilson lud sie 2016
ein, ihn bei der USA-Tournee zu begleiten. Aber davon erzählen wir
dann, wenn die nächste Box erscheint…
Quasi als Kontrapunkt gibt es zum Abschluss dieser Box das komplette
Gegenteil: Das Akustik Album ist das erste komplett
unveröffentlichte Album in dieser Box. Und auch hier
beschränkt er sich nicht einfach nur auf die akustische Gitarre.
Gerade als man beginnt zu denken, dass das auf Dauer auch etwas
eintönig werden könnte, wechselt er die Arrangements: mal
ganz spartanisch, fast Acappella, mal symphonisch, wobei die Streicher
hier vom Keyboard kommen dürften, aber das ändert an der Idee
ja nichts. Also bleibt es auch hier spannend und abwechslungsreich und
einfach nur schön. Ein toller Schluss. Für eine Megasammlung
großer Rock Komposition.
Die Box enthält schließlich noch eine Blue-Ray mit u.a.
Atmos- und 5.1-Mixen sowie ein 76seitiges Buch dazu. Kompliment
für so eine Arbeit!
Für KW 49: Blackout Problems - Songs (Munich Warehouse/The Orchard)
So baut man sich einen Schuh draus. Die Münchener hatten in den
fast zwei Jahren seit ihrem letzten Album „Riot“ immer
wieder  mal
eine neue Single veröffentlicht, gerne begleitet von Videos und
Posts in den sozialen Medien und ohne Hinweis auf eine anstehende
Album-Veröffentlichung. Dadurch beschlich einen schon langsam das
Gefühl, das wäre eine neue Anpassung an den Zeitgeist –
der seit ein paar Jahren vermehrt EPs statt Alben auf den Markt
spült. Schließlich hatten sogar die Classic Rocker Journey
schon 2005 festgestellt, dass es sich doch eigentlich gar nicht mehr
lohnt, ein Album zu veröffentlichen, wenn es doch nur im Internet
geklaut wird (siehe Interview mit Jonathan Cain hier).
Aber glücklicherweise hat der Markt ja einen Weg gefunden, auch
auf diesem Weg noch Geld zu verdienen – und sind die Blackout
Problems noch alte Schule genug, um eine Albumveröffentlichung als
lohnenswert zu betrachten. Zumal sie in den letzten zehn Jahren immer
wieder mal einzelne Songs veröffentlicht hatten – oder auch
nicht, sprich: geschrieben hatten ohne sie zu veröffentlichen.
Darunter Songs wie "Rome", der schon zu den Fan-Lieblingen bei den
Liveshows der Band gehört. Oder ein Song wie
„On“, der hier zum ersten Mal vorgestellt wird. Insgesamt
12 Songs, die zusammen locker ein Album machen. 12 Songs, die
einerseits bunt zusammengewürfelt sind, die aber trotzdem vieles
zusammengehören. Oder wie Sänger und Gitarrist Mario Radetzky
es passend ausdrückt: „12 Songs, die … auf eine
schöne, verrückte Art und Weise miteinander verbunden sind,
und unsere Geschichte erzählen. Was mir besonders dabei
auffällt ist, dass wir uns treu geblieben sind. Das fühlt
sich sehr gut und stimmig an."
mal
eine neue Single veröffentlicht, gerne begleitet von Videos und
Posts in den sozialen Medien und ohne Hinweis auf eine anstehende
Album-Veröffentlichung. Dadurch beschlich einen schon langsam das
Gefühl, das wäre eine neue Anpassung an den Zeitgeist –
der seit ein paar Jahren vermehrt EPs statt Alben auf den Markt
spült. Schließlich hatten sogar die Classic Rocker Journey
schon 2005 festgestellt, dass es sich doch eigentlich gar nicht mehr
lohnt, ein Album zu veröffentlichen, wenn es doch nur im Internet
geklaut wird (siehe Interview mit Jonathan Cain hier).
Aber glücklicherweise hat der Markt ja einen Weg gefunden, auch
auf diesem Weg noch Geld zu verdienen – und sind die Blackout
Problems noch alte Schule genug, um eine Albumveröffentlichung als
lohnenswert zu betrachten. Zumal sie in den letzten zehn Jahren immer
wieder mal einzelne Songs veröffentlicht hatten – oder auch
nicht, sprich: geschrieben hatten ohne sie zu veröffentlichen.
Darunter Songs wie "Rome", der schon zu den Fan-Lieblingen bei den
Liveshows der Band gehört. Oder ein Song wie
„On“, der hier zum ersten Mal vorgestellt wird. Insgesamt
12 Songs, die zusammen locker ein Album machen. 12 Songs, die
einerseits bunt zusammengewürfelt sind, die aber trotzdem vieles
zusammengehören. Oder wie Sänger und Gitarrist Mario Radetzky
es passend ausdrückt: „12 Songs, die … auf eine
schöne, verrückte Art und Weise miteinander verbunden sind,
und unsere Geschichte erzählen. Was mir besonders dabei
auffällt ist, dass wir uns treu geblieben sind. Das fühlt
sich sehr gut und stimmig an."
Für KW 48: Our Oceans - Right Here, Right Now (Long Branch Records)
 Was
für ein Opener! "Golden Rain" startet ganz leise und nimmt dich
nach 37 Sekunden mit einer Gänsehautstimmung mit, steigert sich im
weiteren Verlauf sowohl in Dramatik als auch Gesang und baut noch
weitere Breaks und Wendungen ein. Damit hat dieses Album eigentlich
schon nach 4 Minuten gewonnen. So kraftvoll, wie das Album beginnt, ist
es umso überraschender, dass es danach erst einmal
ungewöhnlich ruhig weitergeht. Da ist zwar in der Stimme oft diese
latente Power, aber Sänger Tymon Kruidenier hält sich - wie
alle anderen - zunächst sehr zurück! Erst drei Songs weiter
kehrt das Rock-Element zurück - und die Niederländer
zurück zu den Überraschungen. In diesem Wechselspiel zwischen
Singer/Songwriter-Sensibilität voller wunderbarer Schönheit
und abwechslungsreichem Art-/Alternative Rock geht es weiter bis zum
abschließenden zweiten Highlight "Abloom". In "If only" kommt
plötzlich auch noch Gastsängerin Evvie mit einem Soloauftritt
in bester Archive-Manier ins Spiel. Alles sehr schön! Tolle Songs,
tolles Album!
Was
für ein Opener! "Golden Rain" startet ganz leise und nimmt dich
nach 37 Sekunden mit einer Gänsehautstimmung mit, steigert sich im
weiteren Verlauf sowohl in Dramatik als auch Gesang und baut noch
weitere Breaks und Wendungen ein. Damit hat dieses Album eigentlich
schon nach 4 Minuten gewonnen. So kraftvoll, wie das Album beginnt, ist
es umso überraschender, dass es danach erst einmal
ungewöhnlich ruhig weitergeht. Da ist zwar in der Stimme oft diese
latente Power, aber Sänger Tymon Kruidenier hält sich - wie
alle anderen - zunächst sehr zurück! Erst drei Songs weiter
kehrt das Rock-Element zurück - und die Niederländer
zurück zu den Überraschungen. In diesem Wechselspiel zwischen
Singer/Songwriter-Sensibilität voller wunderbarer Schönheit
und abwechslungsreichem Art-/Alternative Rock geht es weiter bis zum
abschließenden zweiten Highlight "Abloom". In "If only" kommt
plötzlich auch noch Gastsängerin Evvie mit einem Soloauftritt
in bester Archive-Manier ins Spiel. Alles sehr schön! Tolle Songs,
tolles Album!
Für KW 47: Astronoid - Stargod (3DOT Recordings)
AOP : Adult Orientated Punk :-) In Anlehnung an den Begriff AOR würde ich hier mal einen neuen Namen ins Feld werfen. Sie ver mischen die Sound-Ästhetik von Angels & Airwaves mit der
Schmissigkeit des Punk und der Melodik und den Gitarrensoli des AOR.
Das zündet eigentlich ganz gut.
mischen die Sound-Ästhetik von Angels & Airwaves mit der
Schmissigkeit des Punk und der Melodik und den Gitarrensoli des AOR.
Das zündet eigentlich ganz gut. Damit haben sie die musikalische Ausrichtung seit ihrem Vorgänger „Radiant Bloom“ (s.u.) radikal geändert, da war vieles noch sehr viel schwerfälliger, langsamer mächtiger, PostRock-mäßiger. Und n der tat hatte ich seinerzeit angemerkt, dass das zwar seinen Reiz hat, aber – ähnlich wie Lonely The Brave – die Beschränkung auf weitestgehend durchgehende High Energy Songs auf Dauer auch etwas ermüdend wäre. Und abwechslungsreicher ist das neue Album!
Bleibt die Frage, warum der Opener "Embark" und Track 4 "Third Shot" im Prinzip derselbe Song ist - nur mit 1:30 Längenunterschied... very strange move!
Für KW 46: THE HUNNA blue transitions (EP, FLG)
 Ich
wollte die Briten schon als Newcomer des Jahres einordnen – bis
ich gesehen habe, dass sie bereits 4 CDs seit 2016 vö. haben!
Ähem. Da musste ich erstmal noch ein bisschen Hausaufgaben machen
in punkto Nachhören, und in der Tat, hatten sie auch auf den
Vorgängeralben schon ein paar Song-Highlights – und v.a.
einen klasse Sound für sich gefunden.
Ich
wollte die Briten schon als Newcomer des Jahres einordnen – bis
ich gesehen habe, dass sie bereits 4 CDs seit 2016 vö. haben!
Ähem. Da musste ich erstmal noch ein bisschen Hausaufgaben machen
in punkto Nachhören, und in der Tat, hatten sie auch auf den
Vorgängeralben schon ein paar Song-Highlights – und v.a.
einen klasse Sound für sich gefunden.
Für 2025 haben sie allerdings nur fünf neue Singles zur
Auswahl; die sind aber allesamt zumindest kleine Hits, im Fall von
„Hide & Seek“ und „Bloom“ würde ich
auch von richtigem Potenzial sprechen. Ein Feuerwerk zwischen
Alternative Rock und fast Pop-ähnlichen Hooklines, von dem ich
gerne noch mehr gehört hätte als das. Zusammen mit den
vorigen Veröffentlichungen wird es jedenfalls Zeit, sie hier
anzubringen!
Für KW 45: Airbag - Dysphoria (Live in the Netherlands; Karisma Records)
Auch wenn es an dieser Stelle eher um neue Alben, sprich neues
Material gehen soll und Live-Alben eher die Ausnahme bleiben, gibt es doch manchmal Werke, die eine besondere Aufmerksamkeit verdient
haben. Dazu gehört das neue Album der Norweger, die mit dieser
Zusammenstellung beweisen, auf welch hohem Qualitätsniveau sie
sich bewegen, sowohl im Studio als auch auf der Bühne. Dabei
werden die Songs nur geringfügig verändert oder erweitert,
auch das Publikum ist fast (sprich meistens) nicht zu hören.
Dafür ist ihre Performance unglaublich eindringlich intensiv.
Musikalisch sind sie mit ihrem repetitivem Ansatz und den
fantastischen Gitarreneinlagen das Bindeglied zwischen Archive und Pink
Floyd. Ein Album, in das man sich wunderbar fallen lassen kann.
es doch manchmal Werke, die eine besondere Aufmerksamkeit verdient
haben. Dazu gehört das neue Album der Norweger, die mit dieser
Zusammenstellung beweisen, auf welch hohem Qualitätsniveau sie
sich bewegen, sowohl im Studio als auch auf der Bühne. Dabei
werden die Songs nur geringfügig verändert oder erweitert,
auch das Publikum ist fast (sprich meistens) nicht zu hören.
Dafür ist ihre Performance unglaublich eindringlich intensiv.
Musikalisch sind sie mit ihrem repetitivem Ansatz und den
fantastischen Gitarreneinlagen das Bindeglied zwischen Archive und Pink
Floyd. Ein Album, in das man sich wunderbar fallen lassen kann.
Nachdem Bjørn Riis Anfang des Jahres bereits ein Soloalbum
veröffentlicht hat, ist dies also schon das zweite Album aus dem
Hause Airbag in diesem Jahr :-)
Und um darauf noch einmal zurückzukommen: Mit seinen 5 Songs (plus
Intro) zwischen 6:33 und 11 Minuten hatte er ein klasse
abwechslungsreiches Album, zwischendurch ein paar rockige Sounds, die
den typischen, Pink Floyd angelehnten Sound erweitern und modernisieren
und nicht zuletzt mit dem (einzigen) instrumentalen Stück
"Fimbulvinter" ein kompositorisches Ausrufezeichen gesetzt!
Für KW 44: Gazpacho - Magic 8-Ball (Kscope)
 Ich
gebe zu, ich war auch nicht gleich Feuer und Flamme für das neue
Album der Norweger. Für die auf den ersten Blick eher ruhige
Ausrichtung. Für den lange sehr verhaltenen Beginn und die
darin enthaltene Stimmung der des Openers "Starling". Und auch das
folgende "We are Strangers" ist mit seiner Fast
Dancefloor-elektronischen Ausrichtung auch nicht so wirklich meins,
aber diese beiden Pole bilden die Eckpfeiler des Sounds ihres neuen
Albums. Und auch wenn es beim ersten Hören insgesamt relativ ruhig
und melancholisch erscheint, gibt es die begeisternden Rock
Momente, die grandiosen dramatischen Steigerungen, die dieses Album so
besonders machen. Und wenn sie dich erst mal gefangen genommen haben
mit ihrer Stimmung, mit ihren erhabenen Songmomenten und den brillanten
Melodien geht dir so manche Passage auch nicht mehr aus dem Kopf.
Ich
gebe zu, ich war auch nicht gleich Feuer und Flamme für das neue
Album der Norweger. Für die auf den ersten Blick eher ruhige
Ausrichtung. Für den lange sehr verhaltenen Beginn und die
darin enthaltene Stimmung der des Openers "Starling". Und auch das
folgende "We are Strangers" ist mit seiner Fast
Dancefloor-elektronischen Ausrichtung auch nicht so wirklich meins,
aber diese beiden Pole bilden die Eckpfeiler des Sounds ihres neuen
Albums. Und auch wenn es beim ersten Hören insgesamt relativ ruhig
und melancholisch erscheint, gibt es die begeisternden Rock
Momente, die grandiosen dramatischen Steigerungen, die dieses Album so
besonders machen. Und wenn sie dich erst mal gefangen genommen haben
mit ihrer Stimmung, mit ihren erhabenen Songmomenten und den brillanten
Melodien geht dir so manche Passage auch nicht mehr aus dem Kopf.
Für KW 44: HOWLING GIANT - Crucible & Ruin (Magnetic Eye Records)
Ich weiß gar nicht, ob der Bandname und das Cover noch so
passen... das klingt und sieht alles eher nach alten Männern und
Blues Rock aus, als nach dem, was uns die Jungs hier auftischen. Und so alt sehen die vier auch gar nicht aus :-)
Rock aus, als nach dem, was uns die Jungs hier auftischen. Und so alt sehen die vier auch gar nicht aus :-)
Songs wie der energetische, fast Indie Rock-Opener "Canyons" oder
"Archon" sprühen so viel Frische und Elan aus, dass ich nur raten
kann, sich hier von dem Cover nicht zu sehr ablenken zu lassen.
Abgesehen davon heult hier niemand: Sänger Tom Polzine macht einen
exzellenten Job. Von den fantastischen melodischen Gitarrensoli ganz zu
schweigen, die immer noch eine besondere Note mit reinbringen. Ein
bisschen erinnern sie mich hier an The Brew, die mit ihrem Album
“Control” dem Blues eine neue (U2-Rock-)Note
hinzufügten.
Howling Giant kommen aus Nashville, TN, "Crucible & Ruin" ist ihr
drittes Album nach drei EPs und dem Debütalbum "The Space
between Worlds" 2019. Bereits dem zweiten Album "Glass Future" (2023)
wird ein Quantensprung nachgesagt, das neue Album ist ein weiterer
großer Schritt in punkto Power und Ideenreichtum, so das Info zum
Album, das die Band irgendwo zwischen Stoner Metal und Progressive Rock
einordnet. Dazu beigetragen hat ein zweiter Gitarrist und Keyboarder,
der das Ursprungstrio zum Quartett verwandelt. Im weiteren Verlauf
wird zwar eine gewisse Nähe zum Retro Rock deutlicher, aber immer
noch weit entfernt von jammernden Fabeltieren. Zum Abschluss steigern
sie sich in "Beholder II: Labyrinth" noch einmal in Post
Rock-ähnliche Wall of Sounds und beschließen ein klasse
Rockalbum von einer Band, die sich ihren Platz zwischen Rock, Hard- und
Retro Rock noch suchen muss. Oder für die wir einfach unsere Genre
Brillen abnehmen sollten und einfach goutieren, was sie sehr gut machen.
Für KW 43: Yellowcard - Better Days (Better Noise )
 Sie
waren in den 2000ern die goldene Mitte aus Pop-Punk und
Alternative-Rock, bedienten sich einer Schmissigkeit des ersteren,
bewahrten sich aber das Indie-Rock Feeling des zweiten. Ihr 2003er
Album „Ocean Avenue“ gilt als Genreklassiker. Vor knapp
zehn Jahren kündigten sie ihr letztes Album an und verabschiedeten
sich von der Bildfläche. Einzelne Mitglieder der Band tauchten
solo oder in anderen Konstellationen noch wieder auf, ansonsten war
– auch zwischen den Jungs – weitgehend Sendepause. Bis sie
vor 3 Jahren wieder zusammenkamen und eine Jubiläumstour spielten.
Und jetzt sind sie mit ihrem 11. Album wieder da. Für die Band
stand fest: Ein neues Album sollte nur entstehen, wenn es das
stärkste ihrer Karriere wird. Nun wird das aktuelle Album immer
gerne als das beste angesehen, aber sie hatten auch früher schon
ein paar echte Highlights. Von daher würde ich „Better
Days“ lieber gerne auf eine Stufe mit denen stellen, zugleich
aber zumindest betonen, dass Blink-182s Travis Barkers Produktion und
Drum-Einsatz sicherlich dazu beiträgt, dass es grandios kraftvoll
und zeitgemäß klingt. Und Songs wie der Titelsong,
„City of Angels“ oder „Barely Alive“ sind echte Kracher. Schön, dass sie wieder da sind!
Sie
waren in den 2000ern die goldene Mitte aus Pop-Punk und
Alternative-Rock, bedienten sich einer Schmissigkeit des ersteren,
bewahrten sich aber das Indie-Rock Feeling des zweiten. Ihr 2003er
Album „Ocean Avenue“ gilt als Genreklassiker. Vor knapp
zehn Jahren kündigten sie ihr letztes Album an und verabschiedeten
sich von der Bildfläche. Einzelne Mitglieder der Band tauchten
solo oder in anderen Konstellationen noch wieder auf, ansonsten war
– auch zwischen den Jungs – weitgehend Sendepause. Bis sie
vor 3 Jahren wieder zusammenkamen und eine Jubiläumstour spielten.
Und jetzt sind sie mit ihrem 11. Album wieder da. Für die Band
stand fest: Ein neues Album sollte nur entstehen, wenn es das
stärkste ihrer Karriere wird. Nun wird das aktuelle Album immer
gerne als das beste angesehen, aber sie hatten auch früher schon
ein paar echte Highlights. Von daher würde ich „Better
Days“ lieber gerne auf eine Stufe mit denen stellen, zugleich
aber zumindest betonen, dass Blink-182s Travis Barkers Produktion und
Drum-Einsatz sicherlich dazu beiträgt, dass es grandios kraftvoll
und zeitgemäß klingt. Und Songs wie der Titelsong,
„City of Angels“ oder „Barely Alive“ sind echte Kracher. Schön, dass sie wieder da sind!
Für KW 42: MAMMOTH - The End (BMG)
 Mittlerweile
muss man gar nicht mehr erwähnen, dass Kopf dieser Band
natürlich Wolfgang Van Halen ist, prominenter Sohn von EddieVH.
Womit ihm eine Gabe in die Wiege, zumindest aber in die Kinderstube
gelegt wurde, die er ausgiebig zelebriert und stetig verfeinert. Seine
Fingerfertigkeit ist schlicht atemberaubend, das hat er auch auf seinen
ersten beiden Alben bereits bewiesen. Das ist aber nicht alles. Seine
Songs haben eine unglaubliche Energie, sind wunderbar wuchtig
produziert und fliegen dem Hörer um die Ohren, dass es
schwerfällt, sich auf etwas anderes zu konzentrieren.
Mittlerweile
muss man gar nicht mehr erwähnen, dass Kopf dieser Band
natürlich Wolfgang Van Halen ist, prominenter Sohn von EddieVH.
Womit ihm eine Gabe in die Wiege, zumindest aber in die Kinderstube
gelegt wurde, die er ausgiebig zelebriert und stetig verfeinert. Seine
Fingerfertigkeit ist schlicht atemberaubend, das hat er auch auf seinen
ersten beiden Alben bereits bewiesen. Das ist aber nicht alles. Seine
Songs haben eine unglaubliche Energie, sind wunderbar wuchtig
produziert und fliegen dem Hörer um die Ohren, dass es
schwerfällt, sich auf etwas anderes zu konzentrieren.
Zehn Songs, die allesamt gelungen sind. Eine klasse Dynamik innerhalb
der Songs, prägnante Hooklines und mega Arrangements dürften
Rock-Fans aller Kulör ansprechen. Denn schon Van Halens
Stimme ist alles andere als klischeebeladen, hat mit Hardrock nicht
viel zu tun und wurde durch Produzent Michael "Elvis" Baskette (u.a.
Alter Bridge, Slash) optimal in Szene gesetzt. Entsprechend tourte er
auch mit so unterschiedlichen Acts wie Metallica (die letzten zwei
Jahre), Creed oder den Foo Fighters. Im Herbst kommt er – mit
Myles Kennedy als Support! – auf eigene Tournee. Nein, die
Eddie-Referenz braucht er nicht mehr.
Für KW 41: David Gilmour - The Luck and Strange Concerts (Sony)
 Wer
A sagt, muss auch B sagen… kaum zu glauben, dass die beiden
ehemaligen Masterminds einer der größten Bands der
Rockgeschichte zufällig fast zeitgleich ein Live-Album
veröffentlichen – und dass diese beiden Alben sich in Punkto
Größe kaum voneinander unterscheiden. Und das bezieht sich
sowohl auf den musikalischen Inhalt – der zwangsläufig ein
paar Überschneidungen hat, wenn auch die Umsetzung sich oft extrem
voneinander unterscheidet – als auch das Drumherum zur
Veröffentlichung. Aufgenommen im Zirkus Maximus, Rom, gab
Gilmour bereits im September Film-Vorführung in
ausgewählten Kinos, jetzt gibt es das Ganze auf DVD, 4-LP oder
2-CD Set sowie natürlich in diversen Luxus-Formaten mit Buch etc.
Auch
Gilmour präsentiert eine Mischung aus Floyd und Solo-Songs (die
allesamt rockiger und größer daherkommen, als in den
Studioversionen), ebenfalls 23 Songs die ihn und seine Gitarre in den
Mittelpunkt des Geschehens stellen. Dazu kommt seine Tochter Romany mit
einer mega Performance u.a. in „Between Two Points“ und das
klassische Finale in „Comfortably Numb“. Ich
möchte die Qualität oder Wertigkeit der beiden
Veröffentlichungen hier gar nicht vergleichen. Sie sind beide
schlicht grandios, also (um auf den Eingangssatz zurückzukommen):
Der geneigte Fan wird hier gar nicht auswählen wollen!
Wer
A sagt, muss auch B sagen… kaum zu glauben, dass die beiden
ehemaligen Masterminds einer der größten Bands der
Rockgeschichte zufällig fast zeitgleich ein Live-Album
veröffentlichen – und dass diese beiden Alben sich in Punkto
Größe kaum voneinander unterscheiden. Und das bezieht sich
sowohl auf den musikalischen Inhalt – der zwangsläufig ein
paar Überschneidungen hat, wenn auch die Umsetzung sich oft extrem
voneinander unterscheidet – als auch das Drumherum zur
Veröffentlichung. Aufgenommen im Zirkus Maximus, Rom, gab
Gilmour bereits im September Film-Vorführung in
ausgewählten Kinos, jetzt gibt es das Ganze auf DVD, 4-LP oder
2-CD Set sowie natürlich in diversen Luxus-Formaten mit Buch etc.
Auch
Gilmour präsentiert eine Mischung aus Floyd und Solo-Songs (die
allesamt rockiger und größer daherkommen, als in den
Studioversionen), ebenfalls 23 Songs die ihn und seine Gitarre in den
Mittelpunkt des Geschehens stellen. Dazu kommt seine Tochter Romany mit
einer mega Performance u.a. in „Between Two Points“ und das
klassische Finale in „Comfortably Numb“. Ich
möchte die Qualität oder Wertigkeit der beiden
Veröffentlichungen hier gar nicht vergleichen. Sie sind beide
schlicht grandios, also (um auf den Eingangssatz zurückzukommen):
Der geneigte Fan wird hier gar nicht auswählen wollen!
Für KW 40: Thrice - Horizons West (Epitaph)
Entwarnung: nachdem die erste Single "Gnash" überraschend
heftig in bester (Früh-)Foo Fighters-Manier ausgefallen war, kann
das Album auf ga nzer
Linie überzeugen. Denn da gibt es noch jede Menge anderer Sounds!
Tatsächlich ist es sogar phasenweise sehr ruhig und melancholisch
ausgefallen, womit sie aber nur diese Seite des Vorgängeralbums
"Horizons/East" weiterspinnen. Und kräftigen Alternative Rock gibt
es zwischendurch auch noch. Schon der Opener entwicelt sich nach
sanftem Einstieg zur Punk-Hymne. "Albatross" ist feinster
Thrice-Alternative Rock, genauso wie "The Dark Glow" oder "Vesper
Light". Aber auch die ruhigen Songs können allesamt
überzeugen, nicht zuletzt durch die herrliche raue Stimme von
Sänger Dustin Kensrue, die auch diesem Album wieder das besondere
Etwas mitgibt.
nzer
Linie überzeugen. Denn da gibt es noch jede Menge anderer Sounds!
Tatsächlich ist es sogar phasenweise sehr ruhig und melancholisch
ausgefallen, womit sie aber nur diese Seite des Vorgängeralbums
"Horizons/East" weiterspinnen. Und kräftigen Alternative Rock gibt
es zwischendurch auch noch. Schon der Opener entwicelt sich nach
sanftem Einstieg zur Punk-Hymne. "Albatross" ist feinster
Thrice-Alternative Rock, genauso wie "The Dark Glow" oder "Vesper
Light". Aber auch die ruhigen Songs können allesamt
überzeugen, nicht zuletzt durch die herrliche raue Stimme von
Sänger Dustin Kensrue, die auch diesem Album wieder das besondere
Etwas mitgibt.
Für KW 39: Johnny Marr - Look Out Live! (BMG)
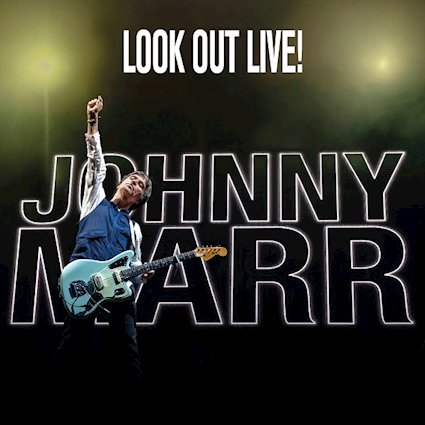 Live
Alben kommen an dieser Stelle eigentlich relativ selten vor, weil es
hier ja eher um neue Musik geht. In diesem Fall muss ich gestehen, dass
trotz meiner jahrelangen DJ-Tätigkeit der Großteil dieser
Songs Neuland für mich ist. Natürlich kenne ich die Hits von
The Smiths, aber darüber hinaus habe ich meist einen Bogen um die
Band gemacht, einfach, weil ich die Stimme von Morrissey nicht mochte,
bzw. mag. In diesem Fall singt Gitarrist Johnny Marr selbst, intoniert
die Smiths-Songs perfekt (und ohne Morrissey-Genöle) und ein
Best-of seines Soloschaffens (das ich nicht kannte) dazu. Von
The Smiths sind eigentlich alle großen Hits mit an Bord –
dazu kommen ein paar Coversongs und Solo-Highlights wie „This
Charming Man” oder “Walk Into The Sea”. Einmal quer
durch sein Repertoire. Perfekte Auswahl und bester Atmosphäre und
Abmischung!
Live
Alben kommen an dieser Stelle eigentlich relativ selten vor, weil es
hier ja eher um neue Musik geht. In diesem Fall muss ich gestehen, dass
trotz meiner jahrelangen DJ-Tätigkeit der Großteil dieser
Songs Neuland für mich ist. Natürlich kenne ich die Hits von
The Smiths, aber darüber hinaus habe ich meist einen Bogen um die
Band gemacht, einfach, weil ich die Stimme von Morrissey nicht mochte,
bzw. mag. In diesem Fall singt Gitarrist Johnny Marr selbst, intoniert
die Smiths-Songs perfekt (und ohne Morrissey-Genöle) und ein
Best-of seines Soloschaffens (das ich nicht kannte) dazu. Von
The Smiths sind eigentlich alle großen Hits mit an Bord –
dazu kommen ein paar Coversongs und Solo-Highlights wie „This
Charming Man” oder “Walk Into The Sea”. Einmal quer
durch sein Repertoire. Perfekte Auswahl und bester Atmosphäre und
Abmischung!
Für KW 38: Mirador - Mirador (Republic Records / Universal)
 Greta
Van Fleet Gitarrist Jake Kiszka scheint nicht ausgelastet zu sein:
Gemeinsam mit Ida Mae-Gitarrist und Sänger Chris Turpin haben sie
sich jetzt noch mit den gemeinsamen Freunden Mikey Sorbello und Nick
Pini zusammengetan und unter dem Namen Mirador ihr selbstbetiteltes
Debütalbum herausgebracht. In seiner etwas angestrengten Art zu
singen erinnert mich Turpin stark an Sammy Hagar – Kiszka scheint
also auf eigenwillige Stimmen zu stehen… die seines Bruders Josh
ist ja auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Und apropos Sammy Hagar -
auch musikalisch geht das durchaus auch in frühe Van Halen
Richtung. Vor allem aber gibt es einige Parallelen zu Greta von
Fleet, auch wenn es Mirador weniger auf große Hymnen angelegt zu
haben scheinen. Ihr Album besteht neben ein paar echt großartigen
Rock-Krachern aus einer sehr geilen Mischung aus Retro Rock, Blues und
Hardrock!
Greta
Van Fleet Gitarrist Jake Kiszka scheint nicht ausgelastet zu sein:
Gemeinsam mit Ida Mae-Gitarrist und Sänger Chris Turpin haben sie
sich jetzt noch mit den gemeinsamen Freunden Mikey Sorbello und Nick
Pini zusammengetan und unter dem Namen Mirador ihr selbstbetiteltes
Debütalbum herausgebracht. In seiner etwas angestrengten Art zu
singen erinnert mich Turpin stark an Sammy Hagar – Kiszka scheint
also auf eigenwillige Stimmen zu stehen… die seines Bruders Josh
ist ja auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Und apropos Sammy Hagar -
auch musikalisch geht das durchaus auch in frühe Van Halen
Richtung. Vor allem aber gibt es einige Parallelen zu Greta von
Fleet, auch wenn es Mirador weniger auf große Hymnen angelegt zu
haben scheinen. Ihr Album besteht neben ein paar echt großartigen
Rock-Krachern aus einer sehr geilen Mischung aus Retro Rock, Blues und
Hardrock!
Für KW 37: Biffy Clyro - Futique (Warner)
 Sie haben die perfekte Balance aus Melodie & Härte –
und basteln daraus nicht nur eine wunderbar abwechslungsreiche Mischung
auf ihrem neuen Album, sondern haben diese Balance auch meistens
innerhalb der einzelnen Songs. Sie starten mit der wichtigsten
Botschaft “with a little love (we can conquer it all)”,
legen dann etwas härter nach (Hunting
Season”) und kombinieren das immer wieder mit melodischen
Zwischenparts. In der ersten Hälfte spielen sie alle
Qualitäten aus, danach werden sie v.a. abwechslungsreicher. In
"Goodbye" und " A Thousand And One” wird es es balladesk, in
“Dearest Amygdala" auch mal etwas Pop-lastig, was insgesamt aber
wunderbar zur Abwechslung beiträgt, den auch hier passiert noch
genug (Gutes), um den Anspruchslevel dieses Albums hoch zun halten. Ein
weiteres Klassealbum der Schotten. Im Februar 2026 auf
Deutschlandtournee!
Sie haben die perfekte Balance aus Melodie & Härte –
und basteln daraus nicht nur eine wunderbar abwechslungsreiche Mischung
auf ihrem neuen Album, sondern haben diese Balance auch meistens
innerhalb der einzelnen Songs. Sie starten mit der wichtigsten
Botschaft “with a little love (we can conquer it all)”,
legen dann etwas härter nach (Hunting
Season”) und kombinieren das immer wieder mit melodischen
Zwischenparts. In der ersten Hälfte spielen sie alle
Qualitäten aus, danach werden sie v.a. abwechslungsreicher. In
"Goodbye" und " A Thousand And One” wird es es balladesk, in
“Dearest Amygdala" auch mal etwas Pop-lastig, was insgesamt aber
wunderbar zur Abwechslung beiträgt, den auch hier passiert noch
genug (Gutes), um den Anspruchslevel dieses Albums hoch zun halten. Ein
weiteres Klassealbum der Schotten. Im Februar 2026 auf
Deutschlandtournee!
Für KW 36: Finn Moriz – Siri spiel Lovesongs [PIAS]
Der Hamburger
Musiker und Singer-Songwriter Finn Moriz ist das neue Talent der
deutschsprachigen Musikszene. Mit seinen ersten Singles  „Wölfe“
und „Lisa“ sorgte er schon für Aufmerksamkeit, und auch der Rest seines
Debütalbums glänzt mit tollen Texten, sehr einfühlsam-eindringlichem
Gesang und einer sehr abwechslungsreichen musikalischen Umsetzung. Da
wechseln klassische Singer-Songwriter-Songs mit tanzbaren Grooves,
lockerem Reggae und ganz ruhigen Momenten. Das ist Musik zwischen Niels
Frevert, Philip Poisel und Enno Bunger – und darüber hinaus. "Es wird
schon gehen, vielleicht auch laufen" oder "Ich sehe nurn noch Punkte,
die miene Sätze nicht mehr haben" (aus: "3 Punkte"): es sind kleine
Wortspiele, wie diese, die seine Texte so interessant machen und denen
man gerne zuhört, weil sie Tiefe besitzen.. Dazu reicht die Musik von
nachdenklich leise über munter rockend ("Lauf"), Dance-Pop ("Worauf
kommt es an") bis zum Peter Fox Reggae Pop ("Bleiben").
„Wölfe“
und „Lisa“ sorgte er schon für Aufmerksamkeit, und auch der Rest seines
Debütalbums glänzt mit tollen Texten, sehr einfühlsam-eindringlichem
Gesang und einer sehr abwechslungsreichen musikalischen Umsetzung. Da
wechseln klassische Singer-Songwriter-Songs mit tanzbaren Grooves,
lockerem Reggae und ganz ruhigen Momenten. Das ist Musik zwischen Niels
Frevert, Philip Poisel und Enno Bunger – und darüber hinaus. "Es wird
schon gehen, vielleicht auch laufen" oder "Ich sehe nurn noch Punkte,
die miene Sätze nicht mehr haben" (aus: "3 Punkte"): es sind kleine
Wortspiele, wie diese, die seine Texte so interessant machen und denen
man gerne zuhört, weil sie Tiefe besitzen.. Dazu reicht die Musik von
nachdenklich leise über munter rockend ("Lauf"), Dance-Pop ("Worauf
kommt es an") bis zum Peter Fox Reggae Pop ("Bleiben").
Ein
Album, das auch für Produzent Philipp Schwär (Kettcar, Revolverheld,
Johannes Oerding) deutlich emotionaler und intensiver als gedacht, wie
er erzählt: “Diese Lieder fühlen sich so an, als hätte jemand 1zu1
meine 20er vertont. Irgendwo zwischen Reeperbahn und Heimatdorf,
zwischen flüchtigen Begegnungen und großer Liebe, zwischen besoffener
Freiheit und kompletter Orientierungslosigkeit. Ich fühlte bei jeder
musikalischen Entscheidung die wir treffen mussten immer sofort was
richtig und was falsch ist - weil ich kannte all diese Gefühle von
denen die Songs erzählen nur zu gut. Sie sind Spiegelbild ihrer Zeit in
all der Zerrissenheit und Angst, gleichzeitig aber auch voller
Hoffnung.” Viel schöner kann man es nicht beschreiben.
Für KW 35: 2AM-DM - Hypotheticals (Columbia Sony Music)
 Pop
Alben kommen an dieser Stelle eher selten vor. Da muss es schon ein
besonderes sein. So wie dieses Debütalbum des norwegischen
Duos Robin Howard und Aksel Krystad aus Oslo mit dem kryptischen
Namen 2AM-DM. Irgendwo zwischen Keane und Leap, die Plattenfirma
schlägt noch King of Leons, The Temper Trap, Two Door Cinema Club
und Kaiser Chiefs vor, was nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ein
Sound zwischen Melodie und Rock, zwischen großer Emorion und
Hymne und mit „Cathedral“, „Hypotheticals“ und
„Hurricane“ ganz großen Songs! Für mich das
Pop-Album des Jahres.:-)
Pop
Alben kommen an dieser Stelle eher selten vor. Da muss es schon ein
besonderes sein. So wie dieses Debütalbum des norwegischen
Duos Robin Howard und Aksel Krystad aus Oslo mit dem kryptischen
Namen 2AM-DM. Irgendwo zwischen Keane und Leap, die Plattenfirma
schlägt noch King of Leons, The Temper Trap, Two Door Cinema Club
und Kaiser Chiefs vor, was nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ein
Sound zwischen Melodie und Rock, zwischen großer Emorion und
Hymne und mit „Cathedral“, „Hypotheticals“ und
„Hurricane“ ganz großen Songs! Für mich das
Pop-Album des Jahres.:-)
Für KW 34: Suede - Antidepressants (BMG RIGHTS)
Sie waren in den 90ern Teil der Britpop Bewegung, aber es fehlte
Ihnen irgendwie immer mehr als nur ein Hit. Wobei: Fehlen ist auch
übertrieben formuliert, sie haben auch so Millionen Alben  verkauft.
Aber im Titelsong erinnern Sie daran, was sie in der Vergangenheit
immer von den Einheit-Pop-Rock Bands unterschieden hat: Sie waren immer
bemüht, eine eigene, bisweilen auch etwas schräge Note mit
reinzubringen. Das scheint Ihnen 2025 nicht mehr so wichtig zu sein:
Ihr neues Album besteht aus einer wunderbaren Songsammlung, die mehr
oder weniger durchgehend überzeugen kann. Und mit den Singles
„Dancing With The Europeans“ und „Trance State“
sowie v.a. „Sound And The Summer“ und „Broken
Music“ ein paar echte Perlen am Start hat. Toller Britpop und
Hymnen, die sie locker auf eine Stufe mit späten Oasis, The Verve,
Blur oder den mittelfrühen Simple Minds stellen. Man könnte
es fast ein reifes Alterswerk nennen, wenn ich nicht meinen würde,
dass sie ein reifes Alter noch gar nicht erreicht haben.
verkauft.
Aber im Titelsong erinnern Sie daran, was sie in der Vergangenheit
immer von den Einheit-Pop-Rock Bands unterschieden hat: Sie waren immer
bemüht, eine eigene, bisweilen auch etwas schräge Note mit
reinzubringen. Das scheint Ihnen 2025 nicht mehr so wichtig zu sein:
Ihr neues Album besteht aus einer wunderbaren Songsammlung, die mehr
oder weniger durchgehend überzeugen kann. Und mit den Singles
„Dancing With The Europeans“ und „Trance State“
sowie v.a. „Sound And The Summer“ und „Broken
Music“ ein paar echte Perlen am Start hat. Toller Britpop und
Hymnen, die sie locker auf eine Stufe mit späten Oasis, The Verve,
Blur oder den mittelfrühen Simple Minds stellen. Man könnte
es fast ein reifes Alterswerk nennen, wenn ich nicht meinen würde,
dass sie ein reifes Alter noch gar nicht erreicht haben.
Für KW 33: Ihlo - Legacy (Kscope)
Album Nummer zwei der britischen Melodic Prog Sensation. Schon im
letzten Jahr hatten wir ja erst das Debüt „Union“ an
dieser Stelle abgefeiert. Ein Album, das eigentlich schon 5 Jahre auf
bandcamp Fans und positive Reaktionen gesammelt hatte, bis die Band
endlich einen Deal angeboten bekommen hat, der attraktiv genug war, um das
Album offiziell rauszubringen. In meiner Rezension schloss ich mit dem
Satz: „Da das Album eigentlich schon lange veröffentlicht
ist, wäre es interessant, zu sehen, inwieweit die Band in der
Zwischenzeit geschafft hat, weite solcher Hochkaräter zu
komponieren!“ Offensichtlich haben sie längst parallel am
Nachfolger gearbeitet, und der liegt mit „Legacy“ jetzt vor.
einen Deal angeboten bekommen hat, der attraktiv genug war, um das
Album offiziell rauszubringen. In meiner Rezension schloss ich mit dem
Satz: „Da das Album eigentlich schon lange veröffentlicht
ist, wäre es interessant, zu sehen, inwieweit die Band in der
Zwischenzeit geschafft hat, weite solcher Hochkaräter zu
komponieren!“ Offensichtlich haben sie längst parallel am
Nachfolger gearbeitet, und der liegt mit „Legacy“ jetzt vor.
Wer vom Debüt schon angefixt war, der braucht beim neuen Album
nicht zu zögern. Ihlo stehen für die perfekte Mischung aus
Melodie und Härte, aus Komplexität und Eingängigkeit,
Atmosphäre und überraschenden Momenten. Bereits im
Vorfeld hatten sie mit drei Vorabveröffentlichungen, v.a.
„Replica“ und „Empire“ reichlich die Vorfreude
gesteigert, und bereits der Opener macht klar, dass die Jungs noch viel
mehr draufhaben. Es ist ihr stetiger Wechsel aus leisen und lauten
Momenten, atmosphärischen, flächigen Keyboards und
präzisem, vielseitigem Drumming, melodischen Gitarrensoli und dem
fantastischen Gesang von Andy Robison, der die Spannung in ihrer Musik
ausmacht. Dabei werden sie nie zu technisch, nie zu komplex, kommen
aber auch komplett ohne Belanglosigkeiten aus. Damit bewegen Sie sich
irgendwo zwischen Enchant, Subsignal und Riverside, zwischen Prog,
Metal und Stadionrock. Absolut gelungen!
Für KW 32: Kilbey Kennedy - Kilbey Kennedy (Box Set)
Ich hatte beim letzten Album der beiden, „Premonition K“
schon festgestellt, dass ich das Treiben von Steve Kilbey 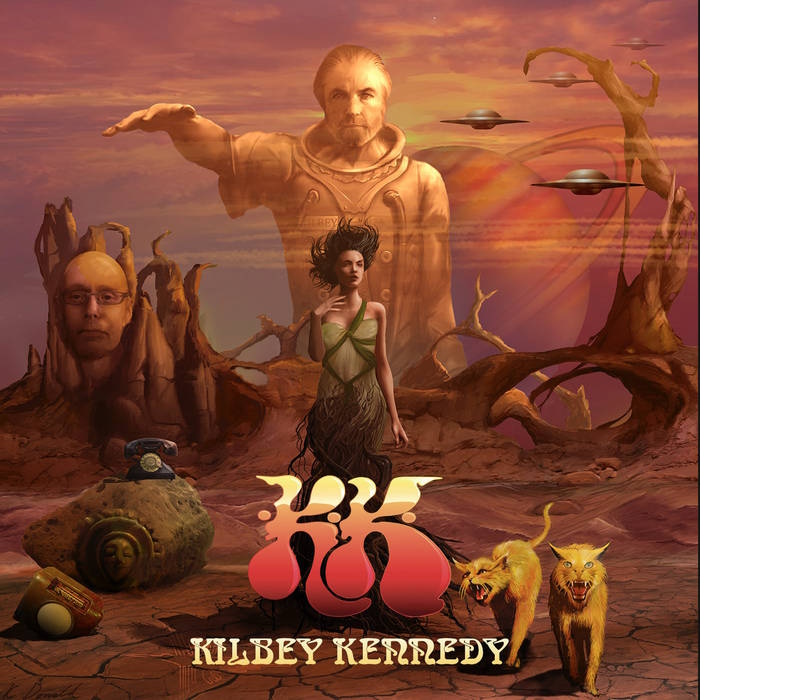 twas
aus den Augen verloren hatte und mich umso mehr freute über die
Wiederentdeckung. Trotzdem war ich bislang nicht groß dazu
gekommen, weiter einzutauchen in sein Schaffen, geschweige denn das an
der Seite von Martin Kennedy.
twas
aus den Augen verloren hatte und mich umso mehr freute über die
Wiederentdeckung. Trotzdem war ich bislang nicht groß dazu
gekommen, weiter einzutauchen in sein Schaffen, geschweige denn das an
der Seite von Martin Kennedy.
Das machen sie mir jetzt ein bisschen leichter, denn es gibt mit dem
Box Set einen Rückblick auf die ganze Trilogie! Drei Alben als
Expanded Versions inklusive jeder Menge Bonus Songs und Alternativer
Mixe, das sind beim "Jupiter 13" Album allein 26 Songs, "Persephone"
ist von 12 auf 28 Songs angewachsen und "Premonition K" bringt es auf
26 Songs (statt 11 im Original). Early, Raw und Alternative Mixe,
Unreleased Songs, Instrumental Mixe und weitere Varianten. Zum
Abschluss gibt es zudem noch 13 Acoustic Mixe, insgesamt sieben Alben,
93 Songs und mehr als 6 Stunden Musik! Was es natürlich keineswegs
einfach macht - aber mit ein bisschen Interesse... und Herzblut... kann
man da als geneigter Hörer schon einiges entdecken! Wollt ihr ein
paar Anspieltipps? Versucht mal „Halfway” und
„Jupiter 13“ (CD: Jupiter 13), „A New Planet”,
„Persephone“ und „Breaking the Fourth Wall”
(CD: Persephone). Es lohnt sich!
Für KW 31: Radiohead - Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 (XL Recordings)
Sie sind ein Phänomen. Als Rockband gestartet mit „OK
Computer“ als innovative Band gefeiert und nach diversen weiteren
Mutationen und Experimenten,  vor
allem mit elektronischen Schwerpunkten und -spielereien als Institution
verehrt. Irgendwann schien das Experimentierpotenzial
ausgeschöpft, die Band zur Seite gelegt und mit The Smile ein
neues Betätigungsfeld eröffnet. Die waren in Vielem
ähnlich, vor allem in dem ruhigen und leicht verdrehten Momenten,
begleitet von Tom Yorkes exzentrischen Gesangsstil. Und nachdem das
letzte Radiohead-Album knapp 10 Jahre her ist und nach zwei Alben (plus
einem Zugabe-Album) von The Smile fragen sich viele zurecht: Gibt es
Radiohead noch? Eine Antwort liefert dieses Album nicht, aber es zeigt
eine Seite der Band, die fast in Vergessenheit geraten ist. Grund
für sein Erscheinen ist, dass Thom Yorke eine Shakespeare-Hamlet/
'Hail to the Thief' -Theaterproduktion gestalten wollte und dafür
altes Live-Material sichtete. Seine Kommentar: „Ich war
schockiert über die Energie, mit der wir damals gespielt haben.
Ich habe uns kaum wiedererkannt, und es hat mir geholfen, einen Weg
nach vorn zu finden. Wir beschlossen, diese Liveaufnahmen zu mischen
und zu veröffentlichen (es wäre verrückt gewesen, sie
nur für uns zu behalten). Das Ganze war ein sehr kathartischer
Prozess. Wir hoffen sehr, dass ihr sie genießt.“
vor
allem mit elektronischen Schwerpunkten und -spielereien als Institution
verehrt. Irgendwann schien das Experimentierpotenzial
ausgeschöpft, die Band zur Seite gelegt und mit The Smile ein
neues Betätigungsfeld eröffnet. Die waren in Vielem
ähnlich, vor allem in dem ruhigen und leicht verdrehten Momenten,
begleitet von Tom Yorkes exzentrischen Gesangsstil. Und nachdem das
letzte Radiohead-Album knapp 10 Jahre her ist und nach zwei Alben (plus
einem Zugabe-Album) von The Smile fragen sich viele zurecht: Gibt es
Radiohead noch? Eine Antwort liefert dieses Album nicht, aber es zeigt
eine Seite der Band, die fast in Vergessenheit geraten ist. Grund
für sein Erscheinen ist, dass Thom Yorke eine Shakespeare-Hamlet/
'Hail to the Thief' -Theaterproduktion gestalten wollte und dafür
altes Live-Material sichtete. Seine Kommentar: „Ich war
schockiert über die Energie, mit der wir damals gespielt haben.
Ich habe uns kaum wiedererkannt, und es hat mir geholfen, einen Weg
nach vorn zu finden. Wir beschlossen, diese Liveaufnahmen zu mischen
und zu veröffentlichen (es wäre verrückt gewesen, sie
nur für uns zu behalten). Das Ganze war ein sehr kathartischer
Prozess. Wir hoffen sehr, dass ihr sie genießt.“
Und in der Tat gibt sich die Band hier unerwartet Rock-lastig, gibt
sich zwischendurch auch Krautrock- und psychedelisch angehaucht
(„Go To Sleep”). Das Publikum feiert sie zurecht. Und
selbnst wenn dieses Album nur 11 der 14 Originalsongs des 2003er
„Hail to the Thief“ Albums wieder auspackt, versieht sie es
mit genügend neuen Elementen, mischt rockige Momente mit
schrägen und experimentellen bis zu ganz ruhigen Tönen und
schafft es damit, einen guten Querschnitt durch den
Radiohead-Soundkosmos abzubilden. Ein Live-Album mit einem sehr eigenen
Ansatz aber durchaus gelungen. Wer auf ein Live-Best-of gewartet hat,
muss noch weiter warten. Faszinierend ist übrigens der
Klatschrhythmus in „We Suck Young Blood“: Ich habe keine
Ahnung, wie die Band das geschafft hat, sein Publikum dahin zu
bringen…
Update 3.9.25, 21.43 Uhr und passend zur Frage nach der Existenz der Band : Soeben erreicht mich diese Mitteilung:
RADIOHEAD KÜNDIGEN EUROPA-LIVEDATES FÜR NOVEMBER UND DEZEMBER 2025 AN
LIVE IN BERLIN (Uber Arena) AM 8. / 9. / 11. UND 12. DEZEMBER
TICKET-REGISTRIERUNG AB FREITAG, 5. SEPTEMBER AUF RADIOHEAD.COM
Für KW 30: Roger Waters - This Is Not A Drill - Live From Prague (Sony Music)
Ein Live Erlebnis mit Roger Waters fehlt mir noch. Aber fehlt es
mir? Nach fragwürdiger Haltung zu Israel und Berichten über
Mondpreise für die Tickets stand es nicht wirklich auf meiner
Bucketlist. Aber als Live-Album kann man das ja mal antesten.
Im Intro beweist er schonmal, dass er sich o.g. Kritik sehr bewusst ist und fährt allen Kritikern, die seine politischen Statements
nicht hören wollen über den Mund. Im Anschluss startet er mit
den beiden größten Pink Floyd-Hits – in interessanten
Arrangements. Mit Samples & Hintergrund Geräuschen sind die
ersten 30 Minuten des Konzerts komplett durchgestylt - und lassen gar
keine Option für Zwischenansagen oder ähnlich
Persönliches zwischen den Songs. Erleben wir ein Konzert oder eine
Revue?
Statements
nicht hören wollen über den Mund. Im Anschluss startet er mit
den beiden größten Pink Floyd-Hits – in interessanten
Arrangements. Mit Samples & Hintergrund Geräuschen sind die
ersten 30 Minuten des Konzerts komplett durchgestylt - und lassen gar
keine Option für Zwischenansagen oder ähnlich
Persönliches zwischen den Songs. Erleben wir ein Konzert oder eine
Revue?
Aber: Er schafft es, das Blatt komplett zu wenden! So unpersönlich
und durchgestylt das Konzert anfängt, so persönlich wird er
im weiteren Verlauf überraschenderweise in seinen Ansagen. Da
kommt in dem Arena Konzert fast so etwas wie Club-Atmosphäre auf.
Und damit sammelt er wahrscheinlich nicht nur bei mir ordentlich
Bonuspunkte. Dazu kommt, dass er eine wirklich spannende Auswahl an
Songs von den ganz frühen bis zu den ganz späten Pink Floyd
Tagen sowie seiner Soloalben ausgesucht hat – und das Konzert
weit über zwei Stunden lang ist. In seinen Solosongs erzählt
er gerne Geschichten – in manchen Pink Floyd Songs übrigens
auch – was ihn vergleichbar mit Fish macht. Und was, wenn man
sich drauf einlässt, seine Konzerte eben auch spannend macht.
Welche Aussage ist ihm heute wichtig?
Ich muss ehrlich zugeben, dass mich zwar seine Alben immer gereizt
haben, dass ich von seinen Live-Qualitäten aber erst jetzt
überzeugt worden bin. Ein tolles Album – zu dem es
übrigens auch eine Filmversion gibt – zunächst in den
Kinos, ab Ende August auch als DVD. Und wenn man die Clips auf seiner
Homepage sieht, dann versteht er es auch, seine Konzerte zu visuellen
Events zu machen - die auch seine Texte und Aussagen eindrucksvoll
unterstützen.
Für KW 29: SubLunar - A Random Moment of Stillness (bandcamp)
 Liegt es an der polnischen Herkunft, oder warum kommt einem zuerst Riverside in den Sinn, wenn man das zweite Album des
Quintetts hört? Atmosphärisch, vom Härtegrad und von der
Stimmung gibt es da jedenfalls durchaus Parallelen. Genauso könnte
man aber auch Pineapple Thief oder Porcupine Tree ins Feld führen.
Fest steht, dass die 5 Jungs von SubLuna Vieles richtig und richtig gut
machen. Ihr Songs besitzen viel Atmosphäre, sehr schöne
Harmonien und Stimmungen. Der Gesang von Łukasz Dumara ist angenehm
(zwischen Bruce Soord und Mariusz Duda), die beiden Gitarren von Michał
Jabłoński und Marcin Pęczkowski wechseln zwischen härterem
Anschlag, sanfter Begleitung und guten Soli. Alles drin!
Songlängen von knapp vier bis 10 Minuten sorgen für
Abwechslung, Shoegaze- und Psychedelic-Elemente erweitern das
Repertoire, sodass, um auf die genannten Bands zurückzukommen, die
Bezeichnung Prog schon fast irreführend ist. Vertrackt wird es
hier nicht, keine Sorge. SubLuna sollten einige Anhänger im
melodischen Rock finden können!
Liegt es an der polnischen Herkunft, oder warum kommt einem zuerst Riverside in den Sinn, wenn man das zweite Album des
Quintetts hört? Atmosphärisch, vom Härtegrad und von der
Stimmung gibt es da jedenfalls durchaus Parallelen. Genauso könnte
man aber auch Pineapple Thief oder Porcupine Tree ins Feld führen.
Fest steht, dass die 5 Jungs von SubLuna Vieles richtig und richtig gut
machen. Ihr Songs besitzen viel Atmosphäre, sehr schöne
Harmonien und Stimmungen. Der Gesang von Łukasz Dumara ist angenehm
(zwischen Bruce Soord und Mariusz Duda), die beiden Gitarren von Michał
Jabłoński und Marcin Pęczkowski wechseln zwischen härterem
Anschlag, sanfter Begleitung und guten Soli. Alles drin!
Songlängen von knapp vier bis 10 Minuten sorgen für
Abwechslung, Shoegaze- und Psychedelic-Elemente erweitern das
Repertoire, sodass, um auf die genannten Bands zurückzukommen, die
Bezeichnung Prog schon fast irreführend ist. Vertrackt wird es
hier nicht, keine Sorge. SubLuna sollten einige Anhänger im
melodischen Rock finden können!
Für KW 28: Badflower - No Place Like Home (Big Machine Rock)
Sie sind für mich immer noch die US-Variante zu den Blackout
Problems aus München. Gegründet 2013 in Los Angeles, verw andelt
das mittlerweile in Nashville ansässige Quartett Stress,
Schlaflosigkeit, Sex, Traurigkeit, Manie, Schmerz und Wahrheit in
offenherzige Alternative-Hymnen. Dabei starteten sie - wie die Blackout
Problems - anfangs deutlich lauter rockend, hatten schon einige
herrlich eindringlich dramatische Emo-/Alternative-/Indie-Rock-Songs
und sind im Laufe ihrer Karriere immer zugänglicher und
Pop-affiner geworden. Was aber an der grundsätzlichen
Qualität ihres Songwritings nicht so viel geändert hat. So
hat auch ihr neues Album wieder genügend erwähnenswertes, um
es hier vorzustellen. Zudem haben sie auf "No Place Like Home" auch ein
paar Songs, die deutlich positiver und energetischer sind, als man nach
dem hier eingangs Beschriebenen erwarten könnte. Wobei es
natürlich auch die melanchlische Seite gibt. Ergo: Ein sehr
abwechslungsreiches Album, bei dem die großen Hits vielleicht
fehlen, das aber trotzdem Spaß macht!
andelt
das mittlerweile in Nashville ansässige Quartett Stress,
Schlaflosigkeit, Sex, Traurigkeit, Manie, Schmerz und Wahrheit in
offenherzige Alternative-Hymnen. Dabei starteten sie - wie die Blackout
Problems - anfangs deutlich lauter rockend, hatten schon einige
herrlich eindringlich dramatische Emo-/Alternative-/Indie-Rock-Songs
und sind im Laufe ihrer Karriere immer zugänglicher und
Pop-affiner geworden. Was aber an der grundsätzlichen
Qualität ihres Songwritings nicht so viel geändert hat. So
hat auch ihr neues Album wieder genügend erwähnenswertes, um
es hier vorzustellen. Zudem haben sie auf "No Place Like Home" auch ein
paar Songs, die deutlich positiver und energetischer sind, als man nach
dem hier eingangs Beschriebenen erwarten könnte. Wobei es
natürlich auch die melanchlische Seite gibt. Ergo: Ein sehr
abwechslungsreiches Album, bei dem die großen Hits vielleicht
fehlen, das aber trotzdem Spaß macht!
Für KW 27: Jacob Roberge - The Passing (bandcamp)
 Ein
neuer Name aus Québec, Kanada, der in den ersten Rezension schon
große Wellen schlägt und für den er selber Namen wie
Porcupine Tree, Pink Floyd und Rush mit ins Spiel bringt. Mit
musikalischen Fähigkeiten an Keyboard, Drums, Bass und Gesang (der
manchmal an Richard Marx erinnert) bringt er schon mal eine Menge mit,
eine klassische Gesangsausbildung sorgt auch da dafür eine
wichtige Zutat!
Ein
neuer Name aus Québec, Kanada, der in den ersten Rezension schon
große Wellen schlägt und für den er selber Namen wie
Porcupine Tree, Pink Floyd und Rush mit ins Spiel bringt. Mit
musikalischen Fähigkeiten an Keyboard, Drums, Bass und Gesang (der
manchmal an Richard Marx erinnert) bringt er schon mal eine Menge mit,
eine klassische Gesangsausbildung sorgt auch da dafür eine
wichtige Zutat!
Sein Debüt Album beginnt sehr ruhig, steigert sich aber bereits im
Opener in ein einen tollen Rock-Song. Erstes Highlight des Albums ist
das zehnminütige „Petrichor“, dass vor allem mit
fantastischem Gitarrensolo überzeugen kann. Und während
die anderen vier der ersten fünf Songs sich zwischen fünf und
6 Minuten tummeln, kommt das progressive Meisterstück am Ende:
„The Passing“ bringt es auf 32 Minuten und ist das einzige
Stück, dass wirklich den Namen Progrock verdient. Was nicht
despektierlich den anderen fünf Songs gegenüber klingen soll,
denn die sind schon grandios. Der Abschluss Track bringt aber eben eine
ganz neue Note mit rein. Trotz seiner Komplexität und Länge
bleibt Roberge immer melodisch und zugänglich. Herausstechendes
Highlights sind immer wieder die tollen Gitarrensoli. Ein sehr
vielversprechendes Debüt!
Für KW 26: Bruce Springsteen - "Tracks II: The Lost Albums" (Columbia/Legacy)
Aufregende Wochen für Springsteen-Fans! War ich ehrlich gesagt
auch mal, mittlerweile hat sich das ein wenig gelegt, trotzdem konnte
ich nicht umhin, mir diese Box komplett anzuhören. Im Mai erschien
erst seine "Land of Hope & Dreams"-EP mit tollen Live-Versionen und
ein paar beeindruckenden politischen (Anti-Trump-)Statements, dann kam
er für ein paar Stadion-Konzerte nach Deutschland und jetzt folgt
„Tracks II“: Eine Sammlung von sieben CDs, 83 Songs, mehr
als 5 Stunden Musik, offiziell sieben komplett ausformulierte Alben.
Manche der Alben haben zwar noch starken Demo-/Garagen-Geruch, aber es
wäre natürlich trotzdem eine Schande gewesen, sie nicht
zugängig zu machen. Und genauso kann ich mir auch vorstellen, dass
es kein Geschenk gewesen wäre, sich diese Songs noch einmal
vorzunehmen und weiter zu bearbeiten. Also haben wir 83 mehr oder
weniger Songs, bei denen manch gute Ansätze erkennbar sind, und
für die vor allem Fans natürlich unglaublich dankbar sind,
dass sie jetzt veröffentlicht werden. Spannend auch für
nicht Die-Hard Fans ist die Spannbereite, die diese Alben
abdecken. Wobei in den meisten Fällen (nämlich ausgenommen CD
#6, s.u.) jeder Stil nicht untypisch ist für das Gesamtwerk
Springsteens, aber erst hier wird deutlich, wie viel mehr dahinter
steht und wie viele weitere Songs offensichtlich dahinter stecken
können. Zudem macht es offensichtlich einen großen
Unterschied, wo (oder mit wem) die Songs produziert wurden. 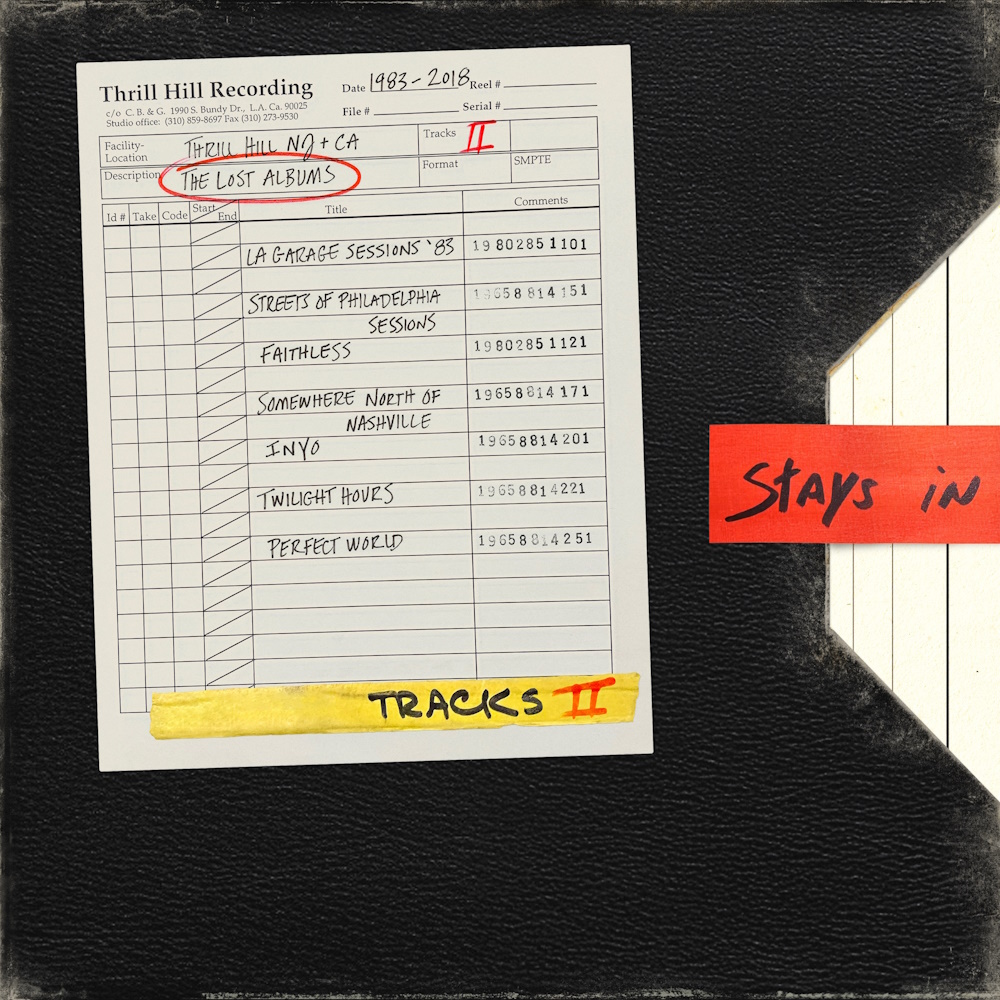
Die ersten 19 Songs sind in L.A. in der Garage entstanden, so zumindest
der Titel des (Doppel-)Albums, weitgehend basierend auf Gitarre und
Gesang, manche Songs haben auch Bass und Schlagzeug mit drin. Die
Songs der „Streets of Philadelphia Sessions“ haben ein
komplett anderes Klangbild, mit Drum Loops und Synthesizern, sind
generell weiter aus produziert, also fertiger, was aber nicht zuletzt
an der gewählten Technik, sprich den Keyboards und Computer Drums
liegt. Wirkliche Highlights sind auch hier aber nicht dabei. Das
folgende „Faithless“ Album ist ein Soundtrack für
einen Film, der nie produziert wurde - komplett ruhig und eher
Springsteen-ungewöhnlich. Es folgt ein Album im
Nashville-Stil: Blues, Country und Americana, Pedal Steel Guitar
inklusive. Positiv anzumerken ist, dass hier ein bisschen mehr
passiert, dass die Songs auch weitgehend fertige Songs sind und dass
hier deutlich mehr Energie im Spiel ist. Allerdings ist der Stil
gewöhnungsbedürftig. „Inyo“ ist wieder das
komplette Gegenteil, akustisch und sehr ruhig.
Die größte Sensation unter den Alben ist dann
„Twilight“: Songs wie „Sunday Love“ und
„Late in the Evening“ hat man von Springsteen noch nicht
gehört. Die Plattenfirma spricht von Orchesterklängen wie in
einem Film Noir der 1950er, ich würde es fast Soul oder Crooning
nennen; fast sensationell. Und wie um den vorletzten Satz
Lügen zu strafen folgt zu guter Letzt noch „Perfect
World“ – und das macht seinem Namen alle Ehre, rechtfertigt
es doch für manche Fan wohl die Anschaffung dieser Box.
Angeführt vom programmatischen „I m Not Sleeping“
(sonst hätte es diese Box wohl gar nicht gegeben!), gibt es hier
ein fertig ausproduziertes Album, das so manchen Hit und so manche
typische Springsteen Wendung enthält. So interessant auch die
(Elemente der) anderen Alben in dieser Box sind, für
„Perfect World“ ist es schon eine Schande, dass es nicht
zur Zeit der Fertigstellung veröffentlicht wurde.
Für KW 25: Nad Sylvan - Mounumentata
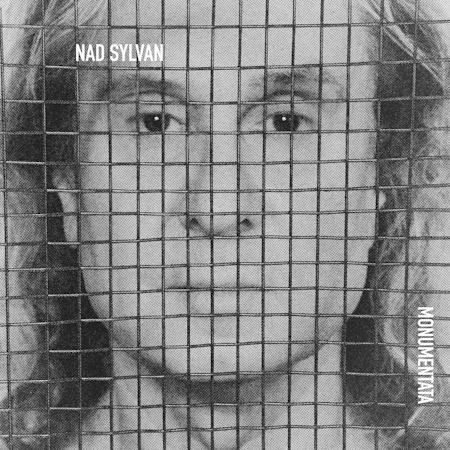 Er
hat eine dieser Stimmen, die man sofort im Progressive Rock verorten
möchte. Hier scheinen Fans weniger verwöhnt und mit Fokus
klarer auf der Musik, als auf dem Gesang. Dennoch, die Stimme von Nad
Sylvan ist gewöhnungsbedürftig. Objektiv betrachtet absolut
einwandfrei, und durch seine Ähnlichkeit zu Peter Gabriel allen
früh-Genesis und Steve Hackett Fans längst ans Herz
gewachsen, ist es u.a. die leicht näselnde Art, die im im
kommerziellen Musik Business vielleicht etwas Erfolgsprobleme bereiten
könnte.
Er
hat eine dieser Stimmen, die man sofort im Progressive Rock verorten
möchte. Hier scheinen Fans weniger verwöhnt und mit Fokus
klarer auf der Musik, als auf dem Gesang. Dennoch, die Stimme von Nad
Sylvan ist gewöhnungsbedürftig. Objektiv betrachtet absolut
einwandfrei, und durch seine Ähnlichkeit zu Peter Gabriel allen
früh-Genesis und Steve Hackett Fans längst ans Herz
gewachsen, ist es u.a. die leicht näselnde Art, die im im
kommerziellen Musik Business vielleicht etwas Erfolgsprobleme bereiten
könnte.
Hier ist sein neues Soloalbum, auf dem er die anvisierte und ihm
bekannte Zielgruppe bestens bedient: melodischer Rock, bisweilen mit
Breaks und schönen Instrumentalparts wunderbar erweitert,
dürften Freunde oben genannter Bands hier wenig auszusetzen haben.
Ein gutes Album auch ohne absolute Highlights.
Für KW 24: Bruce Soord - Bruce Soord (Kscope)
Er hat seine Prog-Leidenschaft ausgetobt mit Vulgar Unicorn, bevor
er mit The Pineapple Thief deutlich eingängigere Wege einschlug.
Noch lange bevor er mit denen richtig durchstartete und nach dem
Einstieg von Drummer Gavin Harrison die Songs auch immer genialer wurden, brauchte er trotzdem auch noch ein
zweites Standbein. Das fand er offensichtlich in seinen Soloalben, auf
denen er seine Fähigkeit, wunderschöne Songs zu komponieren,
beweisen konnte. Die kommen ohne die Arrangement-Hilfen Harrisons aus und sind relativ ruhig. Aber einfach immer
wieder auch unendlich schön! Sein selbstbetiteltes Solodebüt
erschien original vor 10 Jahren, offensichtlich war er der Meinung,
dass es nicht die Aufmerksamkeit bekam, die es verdient gehabt
hätte, trotz der beeindruckenden Rezensionen, die es seinerzeit
erhielt. Also wird es als remasterte Version erneut angeboten.
Unbedingte Hörempfehlung! Und während mein (Blizzard-)Favorit
„Willow Tree” ist, gibt es für Bruce Soord selbst
einen anderen Song, der ihn zurückversetzt in die Zeit, in der er
sich entschieden hat, professioneller Musiker zu werden – noch
ohne die finanziellen Benefits, auf die er )hoffentlich) mittlerweile
blicken kann. Das knapp 2minütige “Field Day Part 2 probably
says everything I ever wanted to say. [It] will forever have a special
place in my heart.”
Songs auch immer genialer wurden, brauchte er trotzdem auch noch ein
zweites Standbein. Das fand er offensichtlich in seinen Soloalben, auf
denen er seine Fähigkeit, wunderschöne Songs zu komponieren,
beweisen konnte. Die kommen ohne die Arrangement-Hilfen Harrisons aus und sind relativ ruhig. Aber einfach immer
wieder auch unendlich schön! Sein selbstbetiteltes Solodebüt
erschien original vor 10 Jahren, offensichtlich war er der Meinung,
dass es nicht die Aufmerksamkeit bekam, die es verdient gehabt
hätte, trotz der beeindruckenden Rezensionen, die es seinerzeit
erhielt. Also wird es als remasterte Version erneut angeboten.
Unbedingte Hörempfehlung! Und während mein (Blizzard-)Favorit
„Willow Tree” ist, gibt es für Bruce Soord selbst
einen anderen Song, der ihn zurückversetzt in die Zeit, in der er
sich entschieden hat, professioneller Musiker zu werden – noch
ohne die finanziellen Benefits, auf die er )hoffentlich) mittlerweile
blicken kann. Das knapp 2minütige “Field Day Part 2 probably
says everything I ever wanted to say. [It] will forever have a special
place in my heart.”
Für KW 23: Joviac - Shards (bandcamp)
Spannender Prog Metal aus Finnland! Wobei Metal schon eigentlich zu
extrem ausgedrückt ist. Sie haben hin und wieder auch eine
härtere  Gitarre am Start, geben sich aber ansonsten irgendwo zwischen Enchant und melodischen Dream Theater die Hand. Zwei
Namen, die mir beim Hören des Albums immer wieder mal in den Sinn
kommen, sowohl musikalisch als auch gesanglich (Ted Leonard). Womit
zwei hochklassige Eckpfeiler ihre Sounds benannt wären, die sie
keineswegs kopieren, sondern die ich hier nur reinbringen
möchte.
Gitarre am Start, geben sich aber ansonsten irgendwo zwischen Enchant und melodischen Dream Theater die Hand. Zwei
Namen, die mir beim Hören des Albums immer wieder mal in den Sinn
kommen, sowohl musikalisch als auch gesanglich (Ted Leonard). Womit
zwei hochklassige Eckpfeiler ihre Sounds benannt wären, die sie
keineswegs kopieren, sondern die ich hier nur reinbringen
möchte.
Ihre technischen, Qualitäten beweisen Sie gleich mit dem
instrumentalen Opener, und im weiteren Verlauf verlegen Sie Ihren
Schwerpunkt ganz gerne in verschiedene Richtungen. Mal elektronischer,
mal härter, mal softer, aber immer mit guten Song-Ideen, toller
musikalischer Umsetzung und viel Abwechslung. In der fast
experimentellen Vielfalt ihres Albums vermutet man fast ein Debüt
einer Band, die sich ungern in eine einzelne Schublade pressen lassen
möchte, und von der man mit so einem Album im Hintergrund als
Startpunkt noch einiges erwarten darf. Aber es ist bereits ihr drittes
Album seit 2017 und macht defintiv Lust, weiter in ihr Oevre
reinzuhören! Vor allem, wenn sie dann auch nocht mit dem
elfminütigen Longtrack zum Abschluss (plus passendem
zweiminütigen Acapella-Intro) beweisen, dass sie durchaus wissen,
was der anspruchsvolle ProgRock-Fan gerne hat :-) Klasse!
Für KW 22: Ghost Of The Machine - Empires Must Fall (bandcamp)
Ist Neoprog eigentlich noch Neo(prog), wenn es ihn schon seit Jahrzehnten gibt? Beschreibt der Name  das
Genre und damit einen Stil gut genug, um ihn auch heute immer noch
benutzen zu können? Ich denke schon. Wobei bei längerem
Hören des zweiten Albums der Briten diese Frage immer mehr in den
Hintergrund rückt und die musikalischen Fähigkeiten und
Ähnlichkeiten zu Bands wie u.a. Arena, die ja nun nicht mehr
wirklich zum Neoprog gehören, immer deutlicher werden.
das
Genre und damit einen Stil gut genug, um ihn auch heute immer noch
benutzen zu können? Ich denke schon. Wobei bei längerem
Hören des zweiten Albums der Briten diese Frage immer mehr in den
Hintergrund rückt und die musikalischen Fähigkeiten und
Ähnlichkeiten zu Bands wie u.a. Arena, die ja nun nicht mehr
wirklich zum Neoprog gehören, immer deutlicher werden.
Hauptanlass für die spontane Assoziation war eigentlich vor allem
der Gesang, der an manchen Vertreter dieser Spielart aus den Achtzigern
und Neunzigern erinnert. Aber je länger man den Songs und der
Stimme zuhört, desto mehr kann man sich dran gewöhnen und
sich an den Feinheiten der Songs begeistern. Und dann gibt es davon
einige!
Im Vergleich zum neuen Album war die Genre-Einordnung Neoprog beim
ersten Ghost Of The Machine-Album "Scissorgames" noch sehr viel
eindeutiger. Deswegen ist das zweite Album schon eine deutliche
musikalische Steigerung! Insofern kann ich dieses Album Freunden des
Melodic Rock, verspielten Instrumentalparts und intelligenten
Songwritings nur empfehlen.
Für KW 21: Cardinal Black - Midnight at The Valencia (Thirty Tigers)
 Hat
halt ein bisschen länger gedauert. 2010 gegründet, von Steve
Winwood entdeckt, von Guns´n´Roses-Manager Alan Niven
umworben, legten sie erstmal wieder eine Pause ein, bevor sie sich v.a.
live, u.a. mit wie Peter Frampton, Joe Bonnamassa und Myles Kennedy
einen Namen machten. Jetzt präsentieren sie endlich ihr erstes
Album, von Cyrill Camenzind in Zürich produziert und mit analogen
Vintage-Geräte aufgenommen, sitzt hier jeder Ton richtig. Vom
gefühlvollen Opener über kräftige Rocker und sanfte
Balladen bis zur Abschlusshymne gibt es hier nicht einen einzigen
schwachen Song auf dem Album. Rock, der bisweilen an Hootie & The
Blowfish erinnert, um jetzt mal einen musikalischen Anhaltspunkt zu
geben. Die Hothouse Flowers wären ein weiterer, gerade auch, was
die eingestreuten Soul und Gospelelemente angeht. Ein Album, dem man
z.B. durch Radio Airplay Aufmerksamkeit gönnt. Hört rein!
Hat
halt ein bisschen länger gedauert. 2010 gegründet, von Steve
Winwood entdeckt, von Guns´n´Roses-Manager Alan Niven
umworben, legten sie erstmal wieder eine Pause ein, bevor sie sich v.a.
live, u.a. mit wie Peter Frampton, Joe Bonnamassa und Myles Kennedy
einen Namen machten. Jetzt präsentieren sie endlich ihr erstes
Album, von Cyrill Camenzind in Zürich produziert und mit analogen
Vintage-Geräte aufgenommen, sitzt hier jeder Ton richtig. Vom
gefühlvollen Opener über kräftige Rocker und sanfte
Balladen bis zur Abschlusshymne gibt es hier nicht einen einzigen
schwachen Song auf dem Album. Rock, der bisweilen an Hootie & The
Blowfish erinnert, um jetzt mal einen musikalischen Anhaltspunkt zu
geben. Die Hothouse Flowers wären ein weiterer, gerade auch, was
die eingestreuten Soul und Gospelelemente angeht. Ein Album, dem man
z.B. durch Radio Airplay Aufmerksamkeit gönnt. Hört rein!
Für KW 20: Skunk Anansie - The Painful Truth (FLG/The Orchard/Membran)
Was für ein Erlebnis: Von NDR2 für ihre Reihe stars@ndr2 - Songs & Stories eingeladen, war es auch für die Ba nd
zum 30. Bandjubiläum (!) eine Premiere, so ausführlich auf
der (kleinen) Bühne (vor gerade mal 300 Leuten) über ihre
Songs zu sprechen. Und während ich zuvor noch
befürchtete, hauptsächlich die neuen Songs vorgestellt zu
bekommen, von denen ich lediglich die ersten Singles kannte, war es
genau anders herum. Mit „Lost and Found“ stellten sie
gerade mal eine einzige der neuen Singles vor und spielten sich
ansonsten durch ihr Hit-Repertoire, bzw. da v.a. die Songs, von denen
sie dachten, dass sie am besten in Trio- und Akustikformat
funktionierten. Womit sie mit Songs wie u.a. „Charity“,
"Weak", "Hedonism" oder „Brazen“ genau die Songs
auftischten, die Sängerin Skin mit problematischen Beziehungen
verbindet, was sie immer wieder mit viel Witz und Verve
ausführlich berichtete. Daneben warf sie sich die
„Moderations“-Bälle mit Gitarrist Ace zu, am Keyboard
zudem von Drummer Marks Ehefrau begleitet. Spannend!
nd
zum 30. Bandjubiläum (!) eine Premiere, so ausführlich auf
der (kleinen) Bühne (vor gerade mal 300 Leuten) über ihre
Songs zu sprechen. Und während ich zuvor noch
befürchtete, hauptsächlich die neuen Songs vorgestellt zu
bekommen, von denen ich lediglich die ersten Singles kannte, war es
genau anders herum. Mit „Lost and Found“ stellten sie
gerade mal eine einzige der neuen Singles vor und spielten sich
ansonsten durch ihr Hit-Repertoire, bzw. da v.a. die Songs, von denen
sie dachten, dass sie am besten in Trio- und Akustikformat
funktionierten. Womit sie mit Songs wie u.a. „Charity“,
"Weak", "Hedonism" oder „Brazen“ genau die Songs
auftischten, die Sängerin Skin mit problematischen Beziehungen
verbindet, was sie immer wieder mit viel Witz und Verve
ausführlich berichtete. Daneben warf sie sich die
„Moderations“-Bälle mit Gitarrist Ace zu, am Keyboard
zudem von Drummer Marks Ehefrau begleitet. Spannend!
Zum neuen Album berichteten sie v.a., dass sie neue Wege eingehen
wollten. Produzent David Sitek (TV On The Radio) ermöglichte ihnen
genau das, indem er ihre Spontaneität anstelle von Perfektion
einfing. Das klappt mal besser, mal weniger gut. Anders
ausgedrückt: Mit „Shame”, “Lost And
Found”, “Cheers” oder “My
Greatest Moment“ gibt es ein paar gute Songs, aber ein
großes Highlight ist nicht wirklich dabei. Und insgesamt ist das
Album wohl das poppigste ihrer Karriere. Welche Rolle Sitek jetzt genau
dabei hatte, kann nur gemutmaßt werden.
Für KW 19: Black Map - Hex (Spinefarm)
 2011
erschien das letzte Album von Dredg. Als ungeheuer spannend innovativer
Act zwischen Alternative und Progressive Rock Anfang der 1990er
gestartet, waren sie über die Jahre und Alben im Pop gelandet
– und damit in der Belanglosigkeit? Gitarrist Mark Engles
startete jedenfalls 2014 sein neues Bandprojekt Black Map, deren
Debüt „In Droves“ schließlich 2017 erschien. Und
wo er an der Seite von Ben Flanagan (v, b) und Chris Robyn (d) in
kompakter Form zurück im spannungsreichen Rock gelandet war. Zwar
ohne Prog-Anteile, dafür aber mit einem sehr vielseitigen
Sänger, tollen Hooklines und v.a. guten Songs. Das setzte bereits
„Melodoria” 2022 fort, jetzt erscheint mit
„Hex” Album Nr. 3. Nicht ganz so stadionhymnenveredelt wie
sein Vorgänger aber mit der bewährten Mischung aus guten
Hooklines und Crunch, kraftvollen Powersong und melodischer
Single-Hymne, zwischen Dredg und Soundgarden. Wobei der relativ sanfte
Gesang immer ein ausgleichendes Element bleibt, was die Band sehr
zugänglich macht. Cool!
2011
erschien das letzte Album von Dredg. Als ungeheuer spannend innovativer
Act zwischen Alternative und Progressive Rock Anfang der 1990er
gestartet, waren sie über die Jahre und Alben im Pop gelandet
– und damit in der Belanglosigkeit? Gitarrist Mark Engles
startete jedenfalls 2014 sein neues Bandprojekt Black Map, deren
Debüt „In Droves“ schließlich 2017 erschien. Und
wo er an der Seite von Ben Flanagan (v, b) und Chris Robyn (d) in
kompakter Form zurück im spannungsreichen Rock gelandet war. Zwar
ohne Prog-Anteile, dafür aber mit einem sehr vielseitigen
Sänger, tollen Hooklines und v.a. guten Songs. Das setzte bereits
„Melodoria” 2022 fort, jetzt erscheint mit
„Hex” Album Nr. 3. Nicht ganz so stadionhymnenveredelt wie
sein Vorgänger aber mit der bewährten Mischung aus guten
Hooklines und Crunch, kraftvollen Powersong und melodischer
Single-Hymne, zwischen Dredg und Soundgarden. Wobei der relativ sanfte
Gesang immer ein ausgleichendes Element bleibt, was die Band sehr
zugänglich macht. Cool!
Für KW 18: The Flower Kings - Love (InsideOutMusic / Sony Music)
Es gab Zeiten, in denen mich Roine Stolt und seine Flower Kings umgehauen haben ob ihrer Kreativität und ihren  begnadeten
Songs. deswegen freue ich mich auch immer noch riesig über ein
neues Album der Schweden, wenn auch ihre letzten Werke mich nie so
richtig überzeugen konnten. Das neue Album startet so erfreulich
mitreißend, mit einer guten Melodie, mitreißendem Drive und
einer wirklich positiven Stimmung. Leider bleibt dieser Song damit eine
Ausnahme. Das gesamte folgende Album ist im Slow-Tempobereich, sprich
mit Metronom im Sekundenzeigergeschwindigkeit. Das macht die Songs
für sich nicht unbedingt schlechter, bietet auch die optimale
Spielwiese, um sich instrumental austoben zu können, und
natürlich leben Sie sich aus, sie sind alle Meister ihres Faches
und kreativ sind sie obendrein, mit Jazz-Momenten, perlenden
Pianoläufen und viel Abwechslung – aber ganz ehrlich:
Spektakulär geht anders. Und deswegen ist das langsame Tempo auf
Dauer etwas eintönig, um nicht zu sagen ermüdend. Es gibt
weitere Highlights, wie “Burning Both Edges” oder das
epische 10-Minuten-Finale “Considerations”, aber so richtig
befriedigend, geschweige denn begeisternd ist das nicht.
begnadeten
Songs. deswegen freue ich mich auch immer noch riesig über ein
neues Album der Schweden, wenn auch ihre letzten Werke mich nie so
richtig überzeugen konnten. Das neue Album startet so erfreulich
mitreißend, mit einer guten Melodie, mitreißendem Drive und
einer wirklich positiven Stimmung. Leider bleibt dieser Song damit eine
Ausnahme. Das gesamte folgende Album ist im Slow-Tempobereich, sprich
mit Metronom im Sekundenzeigergeschwindigkeit. Das macht die Songs
für sich nicht unbedingt schlechter, bietet auch die optimale
Spielwiese, um sich instrumental austoben zu können, und
natürlich leben Sie sich aus, sie sind alle Meister ihres Faches
und kreativ sind sie obendrein, mit Jazz-Momenten, perlenden
Pianoläufen und viel Abwechslung – aber ganz ehrlich:
Spektakulär geht anders. Und deswegen ist das langsame Tempo auf
Dauer etwas eintönig, um nicht zu sagen ermüdend. Es gibt
weitere Highlights, wie “Burning Both Edges” oder das
epische 10-Minuten-Finale “Considerations”, aber so richtig
befriedigend, geschweige denn begeisternd ist das nicht.
Water (InsideOutMusic / Sony Music)
 Wer
Neal Morse schon einmal in Persona erlebt hat, wird bestätigen
können, dass man schnell von seinem Charisma erfasst wird. Im
Interview, auf der Bühne, sogar am Telefon kann man ihn als extrem
sympathischen Gesprächspartner erleben.
Wer
Neal Morse schon einmal in Persona erlebt hat, wird bestätigen
können, dass man schnell von seinem Charisma erfasst wird. Im
Interview, auf der Bühne, sogar am Telefon kann man ihn als extrem
sympathischen Gesprächspartner erleben.
Das scheint nicht nur der Presse so zu gehen, sondern auch anderen
Musikern. Egal wen er fragt, sie scheinen alle sofort zu an einer
Zusammenarbeit interessiert. Was natürlich auch an seinen
überzeugenden Songwriting-Qualitäten liegt. In diesem Fall
gibt es einmal wieder eine neue Konstellation rund um Neal Morse, und
die ist mit Chester Thompson, Gitarrist und Sänger Phil Keaggy
sowie Bassist Byron House prominent besetzt. Die Songs tragen die
deutliche Handschrift Morse, aber für die Umsetzung besteht er
selbst darauf, dass sich dieses Mal wieder alles ganz anders
anfühlt. Und in der Tat können das einige jazzige Momente
durchaus bestätigen, wer es jetzt nicht so eng sieht, wird sich
wiederholt an frühere Songs und Arbeiten erinnert fühlen sei
es solo, mit Flying Color oder auch Transatlantic. Was allesamt
perfekte Referenzen sind, weswegen ich an dieser Stelle auch gar nicht
viel über die Musik erzählen muss – für alle Prog-
und Neal Morse-Fans uneingeschränkt empfehlenswert! Umso mehr,
weil neue Mitstreiter am Start sind.
Für KW 16: Temple Fang – Lifted From The Wind (Stickman Records)
Hörte ich da jemand flüstern, die Zeit der finnischen
Wheel wäre schon wieder abgelaufen? Nicht nur ihr Newcomer Bonus
war  nach
den EPS und dem begeistern 2019er Debütalbum „Moving
Backwards“ abgelaufen, auch ihr Einfallsreichtum war
spätestens mit dem 24er „Charismatic Leaders“ zum
Erliegen gekommen. Nun, spätestens jetzt bringt sich ein
Nachfolger in Stellung. Auch Temple Fang kommen aus Amsterdam (s.u.,
Marathon), sie sind passenderweise beim Stickman Records Label
untergekommen und bereits ihr Debüt ließ aufhorchen.
„Lifted from the Wind“ dürfte da noch weiteren Wirbel
erzeugen. Bereits der Opener „The River“ (18min) nimmt den
geneigten Hörer gefangen und während ich bereits auf dem
nächsten Track entgegenfiebere, baut sich ein Monstersong auf, der
alles andere in den Schatten stellt. „Once“ hätte auch
„Once in a Lifetime“ heißen können, denn genau
so ein Song ist das, ein Epic, für das man Jahre gebastelt hat,
bis alles stimmt und der dieses Album wirklich mega veredelt. Ein Song,
den man als Fan der oben beschriebenen Musik definitiv gehört
haben sollte, der schon nach 5 Minuten ein Highlight ist, der aber auch
nach 21 Minuten keine Minute zu lang ist. Und damit noch nicht genug,
zwei weitere Songs knacken die 10-Minuten Marke (12 & 15) und
bringen die CD an den Rand ihrer Kapazität. Der Gesang erinnert
angenehm an den wunderbaren Editor-Sänger, Tom Smith, und Takt und
Tempowechsel, v.a. im abschließenden 15-Minüter "Josphine"
bringen eine zusätzliche Schippe Anspruch mit hinein. Braucht es
weitere Argumente? Also: entweder reisen sich Wheel noch mal wieder
zusammen oder ihr Platz mit anderweitig vergeben.
nach
den EPS und dem begeistern 2019er Debütalbum „Moving
Backwards“ abgelaufen, auch ihr Einfallsreichtum war
spätestens mit dem 24er „Charismatic Leaders“ zum
Erliegen gekommen. Nun, spätestens jetzt bringt sich ein
Nachfolger in Stellung. Auch Temple Fang kommen aus Amsterdam (s.u.,
Marathon), sie sind passenderweise beim Stickman Records Label
untergekommen und bereits ihr Debüt ließ aufhorchen.
„Lifted from the Wind“ dürfte da noch weiteren Wirbel
erzeugen. Bereits der Opener „The River“ (18min) nimmt den
geneigten Hörer gefangen und während ich bereits auf dem
nächsten Track entgegenfiebere, baut sich ein Monstersong auf, der
alles andere in den Schatten stellt. „Once“ hätte auch
„Once in a Lifetime“ heißen können, denn genau
so ein Song ist das, ein Epic, für das man Jahre gebastelt hat,
bis alles stimmt und der dieses Album wirklich mega veredelt. Ein Song,
den man als Fan der oben beschriebenen Musik definitiv gehört
haben sollte, der schon nach 5 Minuten ein Highlight ist, der aber auch
nach 21 Minuten keine Minute zu lang ist. Und damit noch nicht genug,
zwei weitere Songs knacken die 10-Minuten Marke (12 & 15) und
bringen die CD an den Rand ihrer Kapazität. Der Gesang erinnert
angenehm an den wunderbaren Editor-Sänger, Tom Smith, und Takt und
Tempowechsel, v.a. im abschließenden 15-Minüter "Josphine"
bringen eine zusätzliche Schippe Anspruch mit hinein. Braucht es
weitere Argumente? Also: entweder reisen sich Wheel noch mal wieder
zusammen oder ihr Platz mit anderweitig vergeben.
Für KW 15: Marathon - Fading Image
 Die
Holländer rüsten auf: Die Amsterdamer konnten bereits beim
letzten Reeperbahn Festival überzeugen, seitdem
veröffentlichen sie Singles und kommen jetzt endlich mit ihrem
Debütalbum. Und sie steigen gleich mit voller Energie ein und im
Folgenden entwickelt sich dieses Album zu einer echten Perle. Wave,
Indie Rock, Punk, jede Menge Achtziger-Flair und viele gute Songs
zwischen U2 und The Alarm. Schon die ersten beiden Singles machten
klar, dass sie trotz aller Rauheit, immer auch eine schöne Melodik
mit reinbringen, und das zeichnet ihre Songs und dieses Album letztlich
aus.
Die
Holländer rüsten auf: Die Amsterdamer konnten bereits beim
letzten Reeperbahn Festival überzeugen, seitdem
veröffentlichen sie Singles und kommen jetzt endlich mit ihrem
Debütalbum. Und sie steigen gleich mit voller Energie ein und im
Folgenden entwickelt sich dieses Album zu einer echten Perle. Wave,
Indie Rock, Punk, jede Menge Achtziger-Flair und viele gute Songs
zwischen U2 und The Alarm. Schon die ersten beiden Singles machten
klar, dass sie trotz aller Rauheit, immer auch eine schöne Melodik
mit reinbringen, und das zeichnet ihre Songs und dieses Album letztlich
aus.
Für KW 14: IQ – Dominion (GEP)
Sechs Jahre seit „Resistance“, für die Briten eine fast noirmale Wartezeit auf ein neues Album. Eine große Weiterentwicklung muss man trotzdem nicht erwarten – und den meisten Fans ist das gerade recht. Deswegen ist wichtiger, zu schauen, ob die neuen Songs überzeugen können. Fünf sind drauf, mit Spielzeiten von 3 bis 22 Minuten („The Unknown Door”), wobei gerade die beiden Longtracks („Far From Here“ bringt es auf 12.44) nicht auf voller Länge überzeugen können. Hooklines waren früher ihre große Stärke – neben den fantastischen Sounds & Soli, die es auch auf dem neuen Album wieder in aller Grandezza gibt. Alles andere ist auf dem ansonsten eher durchschnittlichen und nicht durchweg befriedigenden Album lohnt, genauer hinzuhören.
Für KW 13: David Judson Clemmons – Everything A War (7 People Records)

In regelmäßiger Unregelmäßigkeit veröffentlicht David Judson Clemmons ein neues Album. Früher v.a. in seinen Bandprjekten Damn The Machine, The Fullbliss und Jud, seit 2004 vermehrt unter eigenem Namen. Und genau darauf scheint sich Clemmons jetzt eher zu konzentrieren. Musikalisch hatte sich das ohnehin immer weiter angenähert: Melodischer Rock, irgendwo zwischen Pink Floyd und 12 Drummers Drumming, ein wenig Amplifier-Psychedelic und Songwriter-Style à la Roger Waters und weitere spannende Zutaten machen seine Alben immer wieder aufs Neue hörenswert. Auch das neue Album hat wieder ein paar echte Songkracher auf Lager, das beginnt bereits mit dem mitreißenden Opener, „Learn to resist“ und erreicht den Höhepunkt in „Songs In The Key of You“. Klasse!
Für KW 12: Steven Wilson - The Overview (Virgin Records )
Im Wissen um seine betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten und
Kenntnisse können wir davon ausgehen, dass dieses Album nicht
zufällig entstanden ist. Und so, wie es ausgefallen ist,
würde ich mal sagen, dass es ihm in erster Linie um die
Wiederherstellung seines guten Rufes ging, weniger um ein musikalisches
Statement. Denn dass er sich verrannt hatte, vor allem mit dem letzten
Album, dürfte wohl unbestritten sein.
Gestehen wir ihm doch außerdem zu, ein Album zu machen, auf das er einfach Lust hatte. Nicht jedes Album muss  zwangsläufig
ein neuer Meilenstein sein, geschweige denn ein neues Meisterwerk. Also
nehmen wir das neue Album als willkommenen Grund für eine neue
Tournee und vielleicht gerade im Hinblick darauf auch einfach als
Standortbestimmung. Dann könnte man hoffnungsvoll annehmen, dass
er sich auf seine früheren, wenn nicht sogar Anfangstage
zurückbesinnt, Zeiten seines Solo Debüts
„Insurgentes“ oder seine (zumeist solo betriebene)
Porcupine Tree-Anfangszeit, die ja noch sehr Pink Floyd- und
Psychedelic-lastig war. Denn das sind schon mal zwei Grundpfeiler
dieser neuen Platte, zu der auch das Thema des Albums passt,
nämlich der (Über-)Blick des Astronauten auf die Erde.
zwangsläufig
ein neuer Meilenstein sein, geschweige denn ein neues Meisterwerk. Also
nehmen wir das neue Album als willkommenen Grund für eine neue
Tournee und vielleicht gerade im Hinblick darauf auch einfach als
Standortbestimmung. Dann könnte man hoffnungsvoll annehmen, dass
er sich auf seine früheren, wenn nicht sogar Anfangstage
zurückbesinnt, Zeiten seines Solo Debüts
„Insurgentes“ oder seine (zumeist solo betriebene)
Porcupine Tree-Anfangszeit, die ja noch sehr Pink Floyd- und
Psychedelic-lastig war. Denn das sind schon mal zwei Grundpfeiler
dieser neuen Platte, zu der auch das Thema des Albums passt,
nämlich der (Über-)Blick des Astronauten auf die Erde.
Sportlich gesprochen wird er mit diesem Album am Ende des Jahres nicht
um die Meisterschaft spielen, künstlerisch präsentiert er
aber einige tolle Finessen. Manche Sounds und Passagen erinnern an
„Hand.Cannot.Erase“ oder auch an andere Phasen seiner
Karriere. Soll heißen: wirklich Neues präsentiert er hier
nicht, aber eine spannende musikalische Reise mit 2,3 Songs, die
durchaus auch (Prog Rock –)Radio tauglich zu nennen wären.
2,3 Songs, neben zugegebenermaßen einigem Füllmaterial
(große Teile des Albums klingen und sind ungefähr so
spannend wie eine spontane Jam Session, bei der man dieses Ergebnis
Steven Wilson in ähnlicher Qualität zutrauen
würde).
Und diese 2,3 Songs sind, abgesehen von der netten Idee, die beiden
Long Tracks auch noch mal als unterteilte elf Tracks mit auf die CD zu
packen, die einzige Reminiszenz an die relativ kommerzielle Idee der
letzten 2 Alben, womit wir wieder beim Anfang dieses Textes sind. Ergo:
Es wird sich doch wohl niemand über den neuerlichen
Richtungswechsel beschweren wollen, oder?
Für KW 11: Curtis Stigers - Songs From My Kitchen, Volume 1 (Pandemic Poodle Records/ Membran)
 „Some
things you don’t forget“ (aus: "Golden Thread"): fünf
Jahre ist es jetzt her, seit dieser unglaubliche Virus über uns
und vor allem auch über die Musikbranche hergefallen ist, und so
viele Dinge verändert hat. Und vieles von dem ist schon wieder so
lange her, dass man es fast schon wieder vergessen hat. Einer, der
wirklich durch die Pandemie geholfen hat, mit seinen wöchentlichen
Küchenkonzerten, die er online gestreamt hat, ist Curtis Stigers.
Meist mit Hund, manchmal mit Gästen, und oft mit kleinen
Einspielern hat er immer wieder ein neues Programm auf die Beine
gestellt. Insgesamt waren es mehr als 50 dieser Abende und ich kann
sagen, dass ich immer wieder gerne reingeschaut habe.
„Some
things you don’t forget“ (aus: "Golden Thread"): fünf
Jahre ist es jetzt her, seit dieser unglaubliche Virus über uns
und vor allem auch über die Musikbranche hergefallen ist, und so
viele Dinge verändert hat. Und vieles von dem ist schon wieder so
lange her, dass man es fast schon wieder vergessen hat. Einer, der
wirklich durch die Pandemie geholfen hat, mit seinen wöchentlichen
Küchenkonzerten, die er online gestreamt hat, ist Curtis Stigers.
Meist mit Hund, manchmal mit Gästen, und oft mit kleinen
Einspielern hat er immer wieder ein neues Programm auf die Beine
gestellt. Insgesamt waren es mehr als 50 dieser Abende und ich kann
sagen, dass ich immer wieder gerne reingeschaut habe.
Einen Auszug aus diesen Programmen präsentiert er jetzt hier
– mit dem Zusatz „Volume 1“ deutet er an, dass es
durchaus eine Fortsetzung geben kann – aber nicht muss.
(„Diese Tür lasse ich mir mal offen“). Die Songs
gehören dabei zum ruhigsten, intimsten, was der Kalifornier je
veröffentlicht hat. Und er schafft es, damit ein bisschen von der
Atmosphäre wieder in Erinnerung zu rufen, die seine Konzerte und
die diese Zeit ausmachten. Was ein bisschen beklemmend ist, aber
letztlich vor allem wunderschön. Wir haben diese Zeit
überlebt, überstanden und sie ist Teil unseres Lebens. Danke
für tolle Küchenkonzerte, danke für dieses
Rückblick darauf!
Für KW 10: Everon - Shells (Music Theories Recordings / Mascot Records)
Das ist wohl die größte Überraschung des Jahres bisher: nach 16 Jahren kommt Oliver Philipps mit einem Album ,
mit dem wohl eigentlich keiner mehr gerechnet hat. Spätestens seit
dem Tod seines Partners in Crime“, dem Schlagzeuger Christian
'Moschus' Moos, hatten die allermeisten diese Band wohl ad acta
gelegt. Aber Philips belehrt alle Zweifler eines Besseren: Er macht
genau da weiter, wo er aufgehört hat. Da er ohnehin schon immer
für die Komposition zuständig war, scheint es ihm auch nicht
besonders schwer gefallen zu sein, nach dieser Pause wieder
einzusteigen. Ein absoluter Trademark-Sound, einzigartig und
unerreicht, nicht zuletzt durch den Sound der fantastischen
Gitarrensoli. In der Tat kann ich mich nicht erinnern, außer auf
dem 2017 Album von Cast jemals den Versuch gehört zu haben, diesen
Sound zu kopieren. Also Oliver, bitte überrasche uns auch
weiterhin immer mal mit einem neuen Album!
,
mit dem wohl eigentlich keiner mehr gerechnet hat. Spätestens seit
dem Tod seines Partners in Crime“, dem Schlagzeuger Christian
'Moschus' Moos, hatten die allermeisten diese Band wohl ad acta
gelegt. Aber Philips belehrt alle Zweifler eines Besseren: Er macht
genau da weiter, wo er aufgehört hat. Da er ohnehin schon immer
für die Komposition zuständig war, scheint es ihm auch nicht
besonders schwer gefallen zu sein, nach dieser Pause wieder
einzusteigen. Ein absoluter Trademark-Sound, einzigartig und
unerreicht, nicht zuletzt durch den Sound der fantastischen
Gitarrensoli. In der Tat kann ich mich nicht erinnern, außer auf
dem 2017 Album von Cast jemals den Versuch gehört zu haben, diesen
Sound zu kopieren. Also Oliver, bitte überrasche uns auch
weiterhin immer mal mit einem neuen Album!
Es gab eine Zeit, da zählte dieser Sound zum Gipfel der
Genüsse für mich. Und ehrlich gesagt: Mit fantastischen
Sounds, Melodien und Gitarrensoli schafft es Philips, mich genau dahin
zurück zu beamen und für einige wohlige Schauer auf dem
Rücken zu sorgen. Zusätzlich sorgt er mit Duettsängerin
Helena Iren Michaelsen (u.a. Trail of Tears und Imperia, nebenbei
übrigens auch seine Ehefrau :-) ) für eine sehr nette
Neuerung. Und wer meint, die Texte seien bisweilen zu pathetisch, dem
wird mit #5 "Monster" komplett der Wind aus den Segeln genommen. Was
für ein Song, was für ein Text. Fast zu authentisch, um nicht
autobiografisch zu sein.
Für KW 9: Anxious - Bambi (Run For Cover Records)
 Indie-Rock
der besseren Art! Es gab eine Zeit, da nannte man das Emo-Rock, aber
der Begriff ist aus der Mode gekommen. Die Musik aber offensichtlich
nicht! Indie Rock an der Schwelle zum Punk, allerdings ohne deren
Simplizität, sondern mit viel Melodie, Energie und Dramatik.
Bereits das Debütalbum der Jungs aus New Jersey "Little Green
House" wurde von Fans und Kritikern gefeiert. Anschließend
veröffentlichte die Band drei Singles „Where You
Been“, „Sunsign“ und „Down, Down“, mit
denen sie ihren Sound konsequent weiterentwickelten. Nun knüpft
"Bambi" genau dort an und setzt auf große Gesten – mit den
richtigen Songs! Den Rest kann ich ungekürzt aus dem Info
übernehmen: "Inhaltlich zeichnet das Album ein schonungsloses Bild
des Übergangs ins Erwachsenenleben: Trennungen, Erschöpfung,
die unvermeidlichen Herausforderungen des Erwachsenwerdens –
alles verstärkt durch die Fallstricke, die mit dem schnellen
Aufstieg einer Band und dem ständigen Touren einhergehen. Das
Ergebnis ist ein gewaltiger Entwicklungsschritt und ein Album voller
mitreißender Hymnen." Damn good!
Indie-Rock
der besseren Art! Es gab eine Zeit, da nannte man das Emo-Rock, aber
der Begriff ist aus der Mode gekommen. Die Musik aber offensichtlich
nicht! Indie Rock an der Schwelle zum Punk, allerdings ohne deren
Simplizität, sondern mit viel Melodie, Energie und Dramatik.
Bereits das Debütalbum der Jungs aus New Jersey "Little Green
House" wurde von Fans und Kritikern gefeiert. Anschließend
veröffentlichte die Band drei Singles „Where You
Been“, „Sunsign“ und „Down, Down“, mit
denen sie ihren Sound konsequent weiterentwickelten. Nun knüpft
"Bambi" genau dort an und setzt auf große Gesten – mit den
richtigen Songs! Den Rest kann ich ungekürzt aus dem Info
übernehmen: "Inhaltlich zeichnet das Album ein schonungsloses Bild
des Übergangs ins Erwachsenenleben: Trennungen, Erschöpfung,
die unvermeidlichen Herausforderungen des Erwachsenwerdens –
alles verstärkt durch die Fallstricke, die mit dem schnellen
Aufstieg einer Band und dem ständigen Touren einhergehen. Das
Ergebnis ist ein gewaltiger Entwicklungsschritt und ein Album voller
mitreißender Hymnen." Damn good!
Für KW 8: Marillion - An Hour Before It's Dark Live In Port Zelande 2023 (earMUSIC / Edel)
Was die Briten mit ihren Fan-Conventions geschaffen haben, ist schon einzigartig. Und wer als Fan etwas auf sich  hält,
der sollte sich bei einem dieser Treffen schon mal eingefunden haben
– zumal es neben (meistens) Holland auch in Deutschland schon
Marillion-Wochenenden gab. Seit 2002 machen die Fünf das alle zwei
Jahre mindesten einmal und begeistern immer wieder aufs Neue ein ganzes
Wochenende lang mit ganz besonderen Programmen.
hält,
der sollte sich bei einem dieser Treffen schon mal eingefunden haben
– zumal es neben (meistens) Holland auch in Deutschland schon
Marillion-Wochenenden gab. Seit 2002 machen die Fünf das alle zwei
Jahre mindesten einmal und begeistern immer wieder aufs Neue ein ganzes
Wochenende lang mit ganz besonderen Programmen.
Der Samstag ist „Albumnacht“, d.h. in der Regel das
aktuelle Album, das 2023 natürlich ihr tolles „An Hour
Before It's Dark“ war, wird in ganzer Länge aufgeführt.
Als Zugabe gibt es ausgewählte Meisterwerke, begleitet in diesem
Fall von einem Streichquartett! Und die vier Damen geben den Songs
einen besonderen Schliff, in der DVD-Version ist übrigens mit
„The Space“ noch mit einem Song mehr als auf der
2CD-Version. Wer also dabei war, dieses Mal leider nicht dabei war oder
aber endlich mal ein Gefühl für das besondere Setting dieser
Conventions bekommen möchte, dem sei diese Kostprobe empfohlen.
Toller Sound, tolle Bilder, tolle Songs, eine grandiose Stimmung
– typisch Holland!
Für KW 7: Dream Theater - Parasomnia (InsideOutMusic)
 Genie
und Wahnsinn: vom einen weniger vom anderen mehr. Die Götter des
ProgMetal sind wieder vereint mit ihrem Drummer Mike Portnoy. Und es
scheint, als kehrten sie damit auch zurück an ihrer Anfangstage:
Weniger Melodie, mehr Metal. Leider bleiben die genialen Einfälle
ihrer Vergangenheit weitgehend zurück, und das betrifft vor allem
die Hooklines, die sie ansonsten immer wieder in begeisternder Weise
eingebaut haben. Die ihre Songs so einzigartig machten. So
eingängig trotz aller Komplexität. Auch 2025 können Sie
mit ihrer technischen Brillanz punkten, die Songqualität bleibt
aber irgendwie ein wenig auf der Strecke. Viel Härte, viel
Technik, wenig Melodie. Zwar blitzen zwischendurch immer wieder
melodische Gitarrensoli auf, aber sie sind mehr eine schöne
Ergänzung, als eine logische Erweiterung der Songs. Auch die erste
Ballade des Albums, „Are We Dreaming“ bleibt (für
Dream Theater Verhältnisse) weitgehend belanglos (und ist als
potentielle Hitsingle zumindest in dieser Version auch viel zu sehr auf
Rock produziert), hätte vielleicht durch eines dieser Gitarrensoli
gerettet werden können, wird aber mit einem megalangen Fade-Out
abserviert. Auch das ist einfallslos. Kein Song, den man in
Gänze wirklich als genial bezeichnen könnte, stets
bemüht, aber letztlich ein wenig erfolglos. Zum Abschluss
servieren Sie uns schließlich einen 20 Minuten Longtrack, auf dem
sie die ganze Spielwiese ihrer technischen Möglichkeiten
ausbreiten und auch hier mit tollen Momenten glänzen, aber als
Ganzes will sich auch bei diesem Song keine wirkliche Befriedigung
einstellen.
Genie
und Wahnsinn: vom einen weniger vom anderen mehr. Die Götter des
ProgMetal sind wieder vereint mit ihrem Drummer Mike Portnoy. Und es
scheint, als kehrten sie damit auch zurück an ihrer Anfangstage:
Weniger Melodie, mehr Metal. Leider bleiben die genialen Einfälle
ihrer Vergangenheit weitgehend zurück, und das betrifft vor allem
die Hooklines, die sie ansonsten immer wieder in begeisternder Weise
eingebaut haben. Die ihre Songs so einzigartig machten. So
eingängig trotz aller Komplexität. Auch 2025 können Sie
mit ihrer technischen Brillanz punkten, die Songqualität bleibt
aber irgendwie ein wenig auf der Strecke. Viel Härte, viel
Technik, wenig Melodie. Zwar blitzen zwischendurch immer wieder
melodische Gitarrensoli auf, aber sie sind mehr eine schöne
Ergänzung, als eine logische Erweiterung der Songs. Auch die erste
Ballade des Albums, „Are We Dreaming“ bleibt (für
Dream Theater Verhältnisse) weitgehend belanglos (und ist als
potentielle Hitsingle zumindest in dieser Version auch viel zu sehr auf
Rock produziert), hätte vielleicht durch eines dieser Gitarrensoli
gerettet werden können, wird aber mit einem megalangen Fade-Out
abserviert. Auch das ist einfallslos. Kein Song, den man in
Gänze wirklich als genial bezeichnen könnte, stets
bemüht, aber letztlich ein wenig erfolglos. Zum Abschluss
servieren Sie uns schließlich einen 20 Minuten Longtrack, auf dem
sie die ganze Spielwiese ihrer technischen Möglichkeiten
ausbreiten und auch hier mit tollen Momenten glänzen, aber als
Ganzes will sich auch bei diesem Song keine wirkliche Befriedigung
einstellen.
Für KW 6: Last Train - III (PIAS)
Mit ihrem zweiten Album “The Big Picture” hatte ich in den Franzosen schon einen vielversprechenden Newcomer gesehen ,
nachdem sie im eigenen Land schon fleißig abräumten mit
ihrem Rock zwischen Giant Rooks Vitalität, Lenny Kravitz
Groove und Deep Purple Classic Rock Power. Umso mehr, als sie auch
genügend Coolness besaßen, sich Zeit zu lassen für ein
das abschließende Titelstück in bester Led Zeppelin-Manier
einfach mal 10 Minuten Zeit zu lassen, um durch alle Spielarten des
Rock zu treiben. Nun, gut 4 Jahre später gehören sie noch zu
den Insidertipps: Französische Bands haben es nicht leicht bei
uns. Mal sehen, ob sie einfach nur dranbleiben und Konstanz beweisen
müssen. Auch ihr neues, drittes Album hat einige spannende
Momente! Sie sind ein bisschen rauer, ein bisschen wilder, aber oft
auch sehr ähnlich wie die frühen Kings of Leon. Coole
Stimmungen, sehr coole Songs, ein sehr feines Album! Zwischendurch
haben sich leider ein paar zähere, unspektakuläre Songs
eingeschlichen, aber insgesamt macht es schon Spaß, den Vieren
zuzuhören!
,
nachdem sie im eigenen Land schon fleißig abräumten mit
ihrem Rock zwischen Giant Rooks Vitalität, Lenny Kravitz
Groove und Deep Purple Classic Rock Power. Umso mehr, als sie auch
genügend Coolness besaßen, sich Zeit zu lassen für ein
das abschließende Titelstück in bester Led Zeppelin-Manier
einfach mal 10 Minuten Zeit zu lassen, um durch alle Spielarten des
Rock zu treiben. Nun, gut 4 Jahre später gehören sie noch zu
den Insidertipps: Französische Bands haben es nicht leicht bei
uns. Mal sehen, ob sie einfach nur dranbleiben und Konstanz beweisen
müssen. Auch ihr neues, drittes Album hat einige spannende
Momente! Sie sind ein bisschen rauer, ein bisschen wilder, aber oft
auch sehr ähnlich wie die frühen Kings of Leon. Coole
Stimmungen, sehr coole Songs, ein sehr feines Album! Zwischendurch
haben sich leider ein paar zähere, unspektakuläre Songs
eingeschlichen, aber insgesamt macht es schon Spaß, den Vieren
zuzuhören!
Für KW 5: HEISSKALT - Vom Tun und Lassen (Munich Warehouse)
 Da
sind sie wieder. Nach sechs Jahren Funkstille. Wie es dazu kam? Mit dem
Opener "Alle Zeit" sprechen sie sich selbst den Mut zu, diese
Rückkehr anzugehen. Ein toller Song zwischen Poesie, Frustration,
Hoffnung und Kraft. Die folgende, erste Single war der erste Vorbote
des Albums und wie im Opener mit einer sehr eigenen Mischung aus Spoken
Word und Rockhymne, aus Zurückhaltung und kraftvollem
Rockinstrumentarium. Was OK Kid nur live auf der Bühne schaffen,
setzen Heisskalt auch auf diesem Album um. Auch die folgenden Songs
überzeugen mit guten Texten und mitreißendem Indie Rock. Die
zweite Hälfte des Albums kann diesen Qualitätslöevel
nicht ganz halten, in "Mit Worten und Granaten" wird`S mir
persönlich sogar etwas zun heavy, aber insgesamt ein tolles Album,
das kein Blatt vor den Mund nimmt, geschweige denn musikalisch sich
irgendwelche Grenzen setzt.
Da
sind sie wieder. Nach sechs Jahren Funkstille. Wie es dazu kam? Mit dem
Opener "Alle Zeit" sprechen sie sich selbst den Mut zu, diese
Rückkehr anzugehen. Ein toller Song zwischen Poesie, Frustration,
Hoffnung und Kraft. Die folgende, erste Single war der erste Vorbote
des Albums und wie im Opener mit einer sehr eigenen Mischung aus Spoken
Word und Rockhymne, aus Zurückhaltung und kraftvollem
Rockinstrumentarium. Was OK Kid nur live auf der Bühne schaffen,
setzen Heisskalt auch auf diesem Album um. Auch die folgenden Songs
überzeugen mit guten Texten und mitreißendem Indie Rock. Die
zweite Hälfte des Albums kann diesen Qualitätslöevel
nicht ganz halten, in "Mit Worten und Granaten" wird`S mir
persönlich sogar etwas zun heavy, aber insgesamt ein tolles Album,
das kein Blatt vor den Mund nimmt, geschweige denn musikalisch sich
irgendwelche Grenzen setzt.
Mit der Tournee zum Album warten sie noch bis zum Herbst!
Für KW 4: David Gray - Dear Life (Cargo Records)
Der leise Jahresanfang. Seit Jahrzehnten sträflich
unterbewerteter Songwriter aus Schottland mit seinem zehnten
Album. Und  ohne
den unermüdlichen AirPlay-Einsatz von Radio Jade Ikone und
Gründer Michael Diers wäre er wahrscheinlich auch noch
unbekannter. Dabei gehört er nicht nur auf der Insel zu den
Größen dieses Genres, wenn auch überwiegend mit leisen
Tönen. Da gehört „Plus & Minus“ schon zu den
schnelleren Songs – und ist ein Hörtipp nicht zuletzt durch
den Duettgesang mit der Newcomerin Talia Rae. Und wer meinte, dass im
Befindlichkeitspop der letzten 80 Jahre doch eigentlich schon alles
gesagt ist, dem begegnet Gray mit einem Satz wie „My Eyes made
rain“. Hätte auch schon früher jemand drauf kommen
können. Entsprechend empfehle ich Freunden dieser Richtung, sich
dieses Album anzuhören!
ohne
den unermüdlichen AirPlay-Einsatz von Radio Jade Ikone und
Gründer Michael Diers wäre er wahrscheinlich auch noch
unbekannter. Dabei gehört er nicht nur auf der Insel zu den
Größen dieses Genres, wenn auch überwiegend mit leisen
Tönen. Da gehört „Plus & Minus“ schon zu den
schnelleren Songs – und ist ein Hörtipp nicht zuletzt durch
den Duettgesang mit der Newcomerin Talia Rae. Und wer meinte, dass im
Befindlichkeitspop der letzten 80 Jahre doch eigentlich schon alles
gesagt ist, dem begegnet Gray mit einem Satz wie „My Eyes made
rain“. Hätte auch schon früher jemand drauf kommen
können. Entsprechend empfehle ich Freunden dieser Richtung, sich
dieses Album anzuhören!
Für KW 3: Kyles Tolone - Youth
 Muss
Alternative Rock eigentlich aus den USA kommen, um authentisch zu sein?
Natürlich nicht. Das haben auch diverse Bands aus unseren Regionen
schon zahlreich bewiesen. Auch die Göttinger Kyles Tolone sind
schon eine Weile unterwegs und beweisen mit ihrem neuen Album,
vielleicht mehr als jemals zuvor, dass sie es genauso gut können.
Dass sie Band wie 3 Doors Down oder Prime Circle in Nichts nachstehen.
Denn während früheren Alben früher oder später die
Luft ausgingen, überzeugt das neue Album auf ganzer Linie.
Abwechslungsreichtum, Hocklines, toller Gesang, gute Soli, hier ist
alles drin, was Rockfans brauchen. Und letztlich u.a. in Songs wie
"Open Your Eyes" oder "Days of Haze" mit genügend Harry Styles
Pop-Drive, um auch nicht Grunge-Fans mitzunehmen Herzlichen
Glückwunsch! Save The Date: Am
Samstag, 1. März 25 live in Bremerhaven (Shiva).
Muss
Alternative Rock eigentlich aus den USA kommen, um authentisch zu sein?
Natürlich nicht. Das haben auch diverse Bands aus unseren Regionen
schon zahlreich bewiesen. Auch die Göttinger Kyles Tolone sind
schon eine Weile unterwegs und beweisen mit ihrem neuen Album,
vielleicht mehr als jemals zuvor, dass sie es genauso gut können.
Dass sie Band wie 3 Doors Down oder Prime Circle in Nichts nachstehen.
Denn während früheren Alben früher oder später die
Luft ausgingen, überzeugt das neue Album auf ganzer Linie.
Abwechslungsreichtum, Hocklines, toller Gesang, gute Soli, hier ist
alles drin, was Rockfans brauchen. Und letztlich u.a. in Songs wie
"Open Your Eyes" oder "Days of Haze" mit genügend Harry Styles
Pop-Drive, um auch nicht Grunge-Fans mitzunehmen Herzlichen
Glückwunsch! Save The Date: Am
Samstag, 1. März 25 live in Bremerhaven (Shiva).
Für KW 2: Tremonti - The End Will Show Us How (Napalm Records)
Er kann die Füße nicht still halten - und er kann es offensichtlich ohne seine Bandmitglieder auch genauso gut. Bei  Alter
Bridge und Creed ist Mark Tremonti eigentlich nur für die Gitarren
zuständig, dabei macht er auch als Sänger eine Figur, die
seinen hauptamtlichen Frontmännern Scott Stapp oder Myales Kennedy
in nichts nachsteht. In seiner Band agiert er also wieder an der Seite
von Eric Friedman (Gitarre), Ryan Bennett (Schlagzeug) und Tanner
Keegan (Bass). Und auch was die Abwechslungsreichtum seiner Songs
angeht, bekommt der geneigte Fan hier alles geboten, was man vo seinen
o.g. Bands gewohnt ist. Von daher muss man hier gar nicht weiter
drumherhum reden: Auch sein 6. Soloalbum in 12 Jahren (und, die o.g.
Bands mitgerechnet, sein 19. Album insgesamt) bekommt meine klare
Hörempfehlung. Früher hätte ich von kaufen gesprochen,
aber das scheint ja irgendwie aus der Mode gekommen... Live am
Dienstag, 14.01. Hamburg, Grünspan, weiter geht’s in Berlin,
München, Frankfurt und Köln.
Alter
Bridge und Creed ist Mark Tremonti eigentlich nur für die Gitarren
zuständig, dabei macht er auch als Sänger eine Figur, die
seinen hauptamtlichen Frontmännern Scott Stapp oder Myales Kennedy
in nichts nachsteht. In seiner Band agiert er also wieder an der Seite
von Eric Friedman (Gitarre), Ryan Bennett (Schlagzeug) und Tanner
Keegan (Bass). Und auch was die Abwechslungsreichtum seiner Songs
angeht, bekommt der geneigte Fan hier alles geboten, was man vo seinen
o.g. Bands gewohnt ist. Von daher muss man hier gar nicht weiter
drumherhum reden: Auch sein 6. Soloalbum in 12 Jahren (und, die o.g.
Bands mitgerechnet, sein 19. Album insgesamt) bekommt meine klare
Hörempfehlung. Früher hätte ich von kaufen gesprochen,
aber das scheint ja irgendwie aus der Mode gekommen... Live am
Dienstag, 14.01. Hamburg, Grünspan, weiter geht’s in Berlin,
München, Frankfurt und Köln.
Für KW 1: Everyone Says Hi - Lucky Stars (Chrysalis Records)
 Fangen
wir mal langsam an. Nachdem schon die letzten zwei Wochen des letzten
Jahres ohne auf dieser Seite bemerkenswerte Höhepunkte verliefen,
bleibt es auch jetzt noch relativ unspektakulär. Und mit dem
vorliegenden Titel gibt es auch erst einmal nur eine EP mit fünf
Titeln zum gleichnamigen Album, das am 31. Januar veröffentlicht
wird. Aber darauf können wir uns schon freuen! Everyone Says Hi
ist die neue Band des Kaiser Chiefs' Songwriters, Nick Hodgson. Hodgson
ist Songwriter, Leadsänger, Gitarrist und Frontmann der Band,
seine Mitstreiter Pete Denton am Bass, Glenn Moule am Schlagzeug und
Keyboarder Ben Gordon kommen aus Bands wie The Kooks, The Howling Bells
bzw. Liverpools The Dead 60s, dazu unterstützt ihn der Gitarrist
Tom Dawson aus seiner Heimatstadt Leeds. Und nachdem Hodgson bereits
mehrfach mit Platin ausgezeichnet wurde für Songs mit den Kaiser
Chiefs sowie seinen Kollaborationen mit u.a. Dua Lipa, You Me At Six,
Duran Duran und George Ezra gibt es auch bei Everyone Says Hi klasse
Songs mit Hooklines und ordentlich Hitpotetial. Das war schon bei der
bereits im letzten Juni erschienenen ersten Single „Brain
Freeze“ so und setzt sich fort in den vier weiteren bis jetzt
veröffentlichten Songs - auch wenn „Brain
Freeze“ mein Highlight bleibt. Mal sehen was Ende Januar noch
folgt! Tears For Fears lassen grüßen!
Fangen
wir mal langsam an. Nachdem schon die letzten zwei Wochen des letzten
Jahres ohne auf dieser Seite bemerkenswerte Höhepunkte verliefen,
bleibt es auch jetzt noch relativ unspektakulär. Und mit dem
vorliegenden Titel gibt es auch erst einmal nur eine EP mit fünf
Titeln zum gleichnamigen Album, das am 31. Januar veröffentlicht
wird. Aber darauf können wir uns schon freuen! Everyone Says Hi
ist die neue Band des Kaiser Chiefs' Songwriters, Nick Hodgson. Hodgson
ist Songwriter, Leadsänger, Gitarrist und Frontmann der Band,
seine Mitstreiter Pete Denton am Bass, Glenn Moule am Schlagzeug und
Keyboarder Ben Gordon kommen aus Bands wie The Kooks, The Howling Bells
bzw. Liverpools The Dead 60s, dazu unterstützt ihn der Gitarrist
Tom Dawson aus seiner Heimatstadt Leeds. Und nachdem Hodgson bereits
mehrfach mit Platin ausgezeichnet wurde für Songs mit den Kaiser
Chiefs sowie seinen Kollaborationen mit u.a. Dua Lipa, You Me At Six,
Duran Duran und George Ezra gibt es auch bei Everyone Says Hi klasse
Songs mit Hooklines und ordentlich Hitpotetial. Das war schon bei der
bereits im letzten Juni erschienenen ersten Single „Brain
Freeze“ so und setzt sich fort in den vier weiteren bis jetzt
veröffentlichten Songs - auch wenn „Brain
Freeze“ mein Highlight bleibt. Mal sehen was Ende Januar noch
folgt! Tears For Fears lassen grüßen!
Die CDs der Woche - 2024:
Für KW 50: Thees Uhlmann - Sincerely, Thees Uhlmann. Das Beste von Tomte bis heute.
Ein sympathischer Typ mit teilweise tollen Songs und manchmal
witzigen Texten. Bisweilen schießt er ein weng übers Ziel hinaus, v. a.
wenn man seine Studioalben hört. Aber dafür gibt es ja
Best-of-Kopplungen wie diese. Und weil der Kerl aus Hemmoor schon vor
seiner Solokarriere eine erfolgreiche Karriere als Frontmann von Tomte
gestartet hatte und es von denen auch noch kein Best-of gab, legen GHvC
beide Karrieren einfach mal zusammen. Dafür ist es dann auch ein
Doppelalbum geworden, mit dem der geneigte Fan und/oder Besucher seiner
Konzerte der letzten Jahre so ziemlich alles abgedeckt bekommt, was man
von Thees Uhlmann kennen und haben sollte. Von „Danke für
die Angst“ über „Zum Laichen und Sterben ziehen die
Lachse den Fluss hinauf“ bis „Fünf Jahre nicht
gesungen“ - und sogar noch darüber hinaus: Mit „Egal,
was ich tun werde, ich habe immer an dich gedacht“ gibt es seine
neueste Aufnahme vom Soundtrack zu Charly Hübners Verfilmung
seines Romans „Sophia, der Tod und ich“. Schön!
a.
wenn man seine Studioalben hört. Aber dafür gibt es ja
Best-of-Kopplungen wie diese. Und weil der Kerl aus Hemmoor schon vor
seiner Solokarriere eine erfolgreiche Karriere als Frontmann von Tomte
gestartet hatte und es von denen auch noch kein Best-of gab, legen GHvC
beide Karrieren einfach mal zusammen. Dafür ist es dann auch ein
Doppelalbum geworden, mit dem der geneigte Fan und/oder Besucher seiner
Konzerte der letzten Jahre so ziemlich alles abgedeckt bekommt, was man
von Thees Uhlmann kennen und haben sollte. Von „Danke für
die Angst“ über „Zum Laichen und Sterben ziehen die
Lachse den Fluss hinauf“ bis „Fünf Jahre nicht
gesungen“ - und sogar noch darüber hinaus: Mit „Egal,
was ich tun werde, ich habe immer an dich gedacht“ gibt es seine
neueste Aufnahme vom Soundtrack zu Charly Hübners Verfilmung
seines Romans „Sophia, der Tod und ich“. Schön!
Für KW 49: Madsen - Die Weihnachtsplatte (Goodbye Logik Records)
 Na,
seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Oder schon völlig genervt
von jedes Jahr denselben alten Dauerbrennern? Braucht es eine gewisse
Romantik, um da mitzumischen? Oder einfach nur die richtigen
Wegbegleiter. Auch musikalisch. Madsen haben sich entscheiden, ihren
Teil dazu beizutragen – und sie erledigen den Job gut! Mal
romantisch, mal unprätentiös, manchmal auch richtig laut. Ein
„Weihnachtslied..“ kann ja auch „..zum Tanzen“
gut sein. Damit und mit vielen anderen Texten trifft Frontmann
Sebastian mal wieder wiederholt ins Schwarze und macht dieses Album mit
seinem Mix aus Besinnlichkeit und sozialpolitischem Engagement zu einem
sehr besonderen – und sehr guten – Weihnachtsalbum!
Na,
seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Oder schon völlig genervt
von jedes Jahr denselben alten Dauerbrennern? Braucht es eine gewisse
Romantik, um da mitzumischen? Oder einfach nur die richtigen
Wegbegleiter. Auch musikalisch. Madsen haben sich entscheiden, ihren
Teil dazu beizutragen – und sie erledigen den Job gut! Mal
romantisch, mal unprätentiös, manchmal auch richtig laut. Ein
„Weihnachtslied..“ kann ja auch „..zum Tanzen“
gut sein. Damit und mit vielen anderen Texten trifft Frontmann
Sebastian mal wieder wiederholt ins Schwarze und macht dieses Album mit
seinem Mix aus Besinnlichkeit und sozialpolitischem Engagement zu einem
sehr besonderen – und sehr guten – Weihnachtsalbum!
Für KW 48: Hathors - When The Sun is Out / When Skies Are Grey (Noise Appeal Records)
Bereits der ungewöhnliche Titel des Albums verrät eine
gewisse Ambivalenz – und Kontraste können in der Musik zu den spannendsten Ergebnissen führen. Das fünfte Album des
Schweizer Noise-Rock Trios verarbeitet eingängige Melodien und
harte Gitarren zu einer sehr gelungenen Mischung.
spannendsten Ergebnissen führen. Das fünfte Album des
Schweizer Noise-Rock Trios verarbeitet eingängige Melodien und
harte Gitarren zu einer sehr gelungenen Mischung.
Der Gesang von Gitarrist Marc Bouffé erscheint zunächst
etwas rau, verliert aber seine Sperrigkeit, wenn man sich dran
gewöhnt hat. Zudem überwiegt im weiten Verlauf auch die
Sympathie mit den Songs, die immer wieder mit dem Charme der Foo
Fighters kräftigen Indie Rock mit markanten Hooklines verbinden
und mit gelungener Abwechslung immer wieder für kleine Highlights
sorgen. Zudem passen die harten Vocals zu den Texten über Toxische
Positivität, Liebeskummer, Body Shaming, Depression, Selbstzweifel
und Ängste. Der Waschzettel schlägt The Pixies, Madrugada und
The Wipers als weitere Referenzen vor – kann man so stehen
lassen. Anfang 2025 auf Tournee – neben Köln, Ulm und
Frankfurt auch am Samstag, 8. Februar im Kuba in Bremerhaven. Save the
Date!
Für KW 47: Klone - The Unseen (Pelagic Records)
 Die
Franzosen werden immer besser! Es ist bereits ihr 10. Album, und einmal
mehr machen sie alles richtig. Klasse Songs, klasse Stimmung und
Atmosphäre: Damit erinnern sie 2024 stark an Pineapple Thief.
Dabei bemerkenswert: Die Länge der Songs, zwischen drei und knapp
6 Minuten, kurz und gut! Bestes Beispiel: Die Single
‘Magnetic’, zu der auch Sänger Yann Ligner sagt:
"Seine Stärke liegt in seiner Einfachheit. Auf den Punkt gebracht
ist es ein Hauch frischer Luft. Eine ehrliche, fröhliche Ode an
die Liebe". Das Ganze mit viel Leidenschaft und im fetten Sound.
Lediglich im Gesangsbereich muss
man anmerken, so gut Ligners Stimme ist, so hat sie vereinzelt leichte
Schwächen in Aussprache (typisch französisch wird das
´i´ gerne lang betont...) Die frühere gesangliche
Härte,
die sogar auf dem Vorjahres-Album „Meanwhile“ gelegentlich
noch vorkam, ist 2024 komplett Geschichte, musikalisch gibt es noch ein
paar Referenzen. Eine klasse Mischung aus Rock und Prog, Riff und
Atmosphäre, Grunge und Anathema. In Ergänzung zu
den klasse
kompakten Songs #1-6 gibt es mit dem abschließenden "Spring"
einen 12min Longtrack (inkl 2-min Intro und 5-min
outro :-)) Bleibt in Summe ein sehr gutes, sehr kompaktes Album (mit
atmosphärisch-ausschweifendem Ende).
Die
Franzosen werden immer besser! Es ist bereits ihr 10. Album, und einmal
mehr machen sie alles richtig. Klasse Songs, klasse Stimmung und
Atmosphäre: Damit erinnern sie 2024 stark an Pineapple Thief.
Dabei bemerkenswert: Die Länge der Songs, zwischen drei und knapp
6 Minuten, kurz und gut! Bestes Beispiel: Die Single
‘Magnetic’, zu der auch Sänger Yann Ligner sagt:
"Seine Stärke liegt in seiner Einfachheit. Auf den Punkt gebracht
ist es ein Hauch frischer Luft. Eine ehrliche, fröhliche Ode an
die Liebe". Das Ganze mit viel Leidenschaft und im fetten Sound.
Lediglich im Gesangsbereich muss
man anmerken, so gut Ligners Stimme ist, so hat sie vereinzelt leichte
Schwächen in Aussprache (typisch französisch wird das
´i´ gerne lang betont...) Die frühere gesangliche
Härte,
die sogar auf dem Vorjahres-Album „Meanwhile“ gelegentlich
noch vorkam, ist 2024 komplett Geschichte, musikalisch gibt es noch ein
paar Referenzen. Eine klasse Mischung aus Rock und Prog, Riff und
Atmosphäre, Grunge und Anathema. In Ergänzung zu
den klasse
kompakten Songs #1-6 gibt es mit dem abschließenden "Spring"
einen 12min Longtrack (inkl 2-min Intro und 5-min
outro :-)) Bleibt in Summe ein sehr gutes, sehr kompaktes Album (mit
atmosphärisch-ausschweifendem Ende).
Für KW 46: Kite Parade - Disparity (White Knight Records)
Er ist ganz schön fix: 2022 gab es das erste Soloalbum von Andy Foster unter dem Namen Kite Parade (CD der Woche KW 15/2022), mit "Disparity" ist er bereits bei Album No.3! Und
obwohl er bereits mit dem Debüt überzeugen konnte, legt er hier definitiv noch
einen drauf. Abgesehen davon, dass es sich hier um ein Konzeptalbum zu handeln
scheint, zumindest musikalisch gehen viele der Songs ineinander über, hat er
v.a. in Sachen Abwechslung einiges zu bieten. Neun Songs zwischen 1:36 und 7:32
mit verschiedenen Stimmungen und Maßen an Komplexität, oft mit viel Energie,
viel Schwung, tollen Harmonien und Soli, da ist viel drin und vieles absolut
richtig gemacht. Dazu kommen tolle Gastsängerinnen wie Christina Booth
(Magenta) und Lynsey Ward sowie ein paar Gastmusiker. Sehr spannend und sehr
gut. Für Freunde melodischen Rocks und Progs, mit Referenzen zu Pineapple
Thief, Steven Wilson und John Mitchell/Lonely Robot. Solltet ihr reinhören!
mit "Disparity" ist er bereits bei Album No.3! Und
obwohl er bereits mit dem Debüt überzeugen konnte, legt er hier definitiv noch
einen drauf. Abgesehen davon, dass es sich hier um ein Konzeptalbum zu handeln
scheint, zumindest musikalisch gehen viele der Songs ineinander über, hat er
v.a. in Sachen Abwechslung einiges zu bieten. Neun Songs zwischen 1:36 und 7:32
mit verschiedenen Stimmungen und Maßen an Komplexität, oft mit viel Energie,
viel Schwung, tollen Harmonien und Soli, da ist viel drin und vieles absolut
richtig gemacht. Dazu kommen tolle Gastsängerinnen wie Christina Booth
(Magenta) und Lynsey Ward sowie ein paar Gastmusiker. Sehr spannend und sehr
gut. Für Freunde melodischen Rocks und Progs, mit Referenzen zu Pineapple
Thief, Steven Wilson und John Mitchell/Lonely Robot. Solltet ihr reinhören!Für KW 45: The Cure - Songs Of A Lost World (Universal)
 Und noch ein Rückkehrer aus den 80ern - mit dem ersten Studioalbum seit 16 Jahren!
Und noch ein Rückkehrer aus den 80ern - mit dem ersten Studioalbum seit 16 Jahren!
Ihre Single "Friday I’m in Love" war ihr Befreiungsschlag. Trotz
früherer Pophits wie "Lovecats" oder "Why can`t I be you" haben
sie erst dort bewiesen, dass sie gar nicht nur immer düster sein
müssen, sondern auch im Grunde ihres Herzens fröhliche
Menschen sind. Seitdem können sie sich im Prinzip alles erlauben.
Da passt jede schwere Melancholie, alle langsamen Takte, jedes
Radiokompatibilität verhöhnende Endlos-Instrumentalintro. Was
man heraus hört, ist schlicht Schönheit! Nicht dass sie das
nicht auch schon immer in ihren Songs hatten, erst seit dem man sie
nicht zwangsläufig in die Gruftie-Ecke stecken muss, darf man
diese Schönheit auch sehen, erkennen und ihnen zugestehen. Und so
sind auch die neuen Songs wieder eine volle Ladung toller Songs
zwischen Pop und Rock, zwischen Gruft und Himmelreich, Melancholie und
mehr oder weniger versteckter Freude. Da muss man weder Cure-Fan noch
selbstmordgefährdet sein, um dieses Album gut zu finden. Sie sind
und bleiben ein Unikat auch 2024.
Für KW 44: Tears For Fears - Songs For A Nervous Planet
(Concord Records / Universal)
Ich liebe diese Band! Ihr Meilenstein-Album war für mich
„Seeds of Love“, ein fantastisches Konzert (in Bremen)
inklusive. Dabei hatten sie schon mit ihren ersten Alben längst
Musikgeschichte geschrieben, weil sie sich immer wieder neu erfinden
konnten und sogar ihrer Zeit immer ein bisschen voraus waren. Und bis
zum genannten Album konnten sie auch immer auf Albumlänge
überzeugen, danach war das nicht immer der Fall. Curt Smith
verließ die Band, bis 2004 veröffentlichte Roland Orzabal
alleine, entweder unter eigenem Namen oder unter dem Bandnamen; hier
gab es immer wieder auch einzelne Highlights, aber insgesamt konnten
ihre Alben bis heute nie mehr voll überzeugen. Jetzt gibt es vier
neue Songs, von denen immerhin die Hälfte überzeugen kann,
die anderen zwei Songs nette Ergänzungen sind. V.a. gibt es aber
ihr erstes Live-(Doppel-)Album! Nach 43 Jahren. Nach zwei
Live-Konzerten auf VHS (1990) und DVD (2006). Und die lassen die
Geschichte der Bands Revue passieren und verdeutlichen einmal mehr, wie
gut sie waren, die meisten wichtigen Songs sind dabei, v.a. auch
von den weniger beachteten Alben. Den Konzertfilm dazu gibt es
zunächst nur im Kino, mal sehen, ob er nachträglich auch noch
veröffentlicht wird. Konzerte gibt es momentan nur in den USA
– mit Ticketpreisen von $ 202$ - 999$... (trotzdem nur noch
Restkarten erhältlich); vielleicht sollten wir uns also lieber an
dieses Album halten! Ein Interview mit Roland Orzabal gibt es hier :-)
Dabei hatten sie schon mit ihren ersten Alben längst
Musikgeschichte geschrieben, weil sie sich immer wieder neu erfinden
konnten und sogar ihrer Zeit immer ein bisschen voraus waren. Und bis
zum genannten Album konnten sie auch immer auf Albumlänge
überzeugen, danach war das nicht immer der Fall. Curt Smith
verließ die Band, bis 2004 veröffentlichte Roland Orzabal
alleine, entweder unter eigenem Namen oder unter dem Bandnamen; hier
gab es immer wieder auch einzelne Highlights, aber insgesamt konnten
ihre Alben bis heute nie mehr voll überzeugen. Jetzt gibt es vier
neue Songs, von denen immerhin die Hälfte überzeugen kann,
die anderen zwei Songs nette Ergänzungen sind. V.a. gibt es aber
ihr erstes Live-(Doppel-)Album! Nach 43 Jahren. Nach zwei
Live-Konzerten auf VHS (1990) und DVD (2006). Und die lassen die
Geschichte der Bands Revue passieren und verdeutlichen einmal mehr, wie
gut sie waren, die meisten wichtigen Songs sind dabei, v.a. auch
von den weniger beachteten Alben. Den Konzertfilm dazu gibt es
zunächst nur im Kino, mal sehen, ob er nachträglich auch noch
veröffentlicht wird. Konzerte gibt es momentan nur in den USA
– mit Ticketpreisen von $ 202$ - 999$... (trotzdem nur noch
Restkarten erhältlich); vielleicht sollten wir uns also lieber an
dieses Album halten! Ein Interview mit Roland Orzabal gibt es hier :-)
Für KW 43: Ihlo – Union Kscope: 11 October 2024
 Ein
neuer Stern! Auf Bandcamp haben sie es längst entdeckt.
Entspannter ProgMetal, gibt es sowas?? Grandioser Sänger,
tolle Songs, wunderschöne Harmonien und eine sehr entspannte
Abwechslung zwischen sehr ruhigen Momenten und kräftigen
Rock-Parts, ohne dabei auf die extremen
Wechsel-Überraschungen mancher Kollegen setzen zu
müssen – Effektivität geht auch anders! Die Songs
stehen im Vordergrund, werden exzellent erweitert durch Soli und Breaks
und machen richtig Spaß. Die perfekte Mischung aus Harmonie,
Härte und Komplexität, irgendwo zwischen Enchant, TesseracT
und Haken, wobei ich das letzte Haken Album zu heavy fand; aber das nur
am Rande. Zum Abschluss gibt’s noch zwei Live Tracks, wobei vor
allem „Hollow“ schon in der Studio Version begeistern kann,
Live hat er noch ein bisschen mehr Power. Da das Album eigentloch schon
lange veröffentlicht ist, wäre es interessant, zu sehen,
inwieweit die Band in der Zwischenzeit geschafft hat, weite solcher
Hochkaräter zu komponieren!
Ein
neuer Stern! Auf Bandcamp haben sie es längst entdeckt.
Entspannter ProgMetal, gibt es sowas?? Grandioser Sänger,
tolle Songs, wunderschöne Harmonien und eine sehr entspannte
Abwechslung zwischen sehr ruhigen Momenten und kräftigen
Rock-Parts, ohne dabei auf die extremen
Wechsel-Überraschungen mancher Kollegen setzen zu
müssen – Effektivität geht auch anders! Die Songs
stehen im Vordergrund, werden exzellent erweitert durch Soli und Breaks
und machen richtig Spaß. Die perfekte Mischung aus Harmonie,
Härte und Komplexität, irgendwo zwischen Enchant, TesseracT
und Haken, wobei ich das letzte Haken Album zu heavy fand; aber das nur
am Rande. Zum Abschluss gibt’s noch zwei Live Tracks, wobei vor
allem „Hollow“ schon in der Studio Version begeistern kann,
Live hat er noch ein bisschen mehr Power. Da das Album eigentloch schon
lange veröffentlicht ist, wäre es interessant, zu sehen,
inwieweit die Band in der Zwischenzeit geschafft hat, weite solcher
Hochkaräter zu komponieren!
Für KW 42: Frost* - Life in the Wires (InsideOutMusic)
Jetzt gehört er also auch endlich zu den Großen. Mit
einem Konzept-Doppelalbum! Was könnte man Größeres erreichen? Nein, Spaß beiseite. Jem Godfrey gehörte bereits
mit dem ersten Album zu den Großen – mit seiner
Vorgeschichte als (Pop-)Produzent und mit dem Songmaterial, das er auf
„Milliontown“, „Experiments in Mass Appeal“ und
„Falling Satellites“ ablieferte – und sogar
darüber hinaus, wie er auf der 8-CD-Box „13 Winters“
bewies.
erreichen? Nein, Spaß beiseite. Jem Godfrey gehörte bereits
mit dem ersten Album zu den Großen – mit seiner
Vorgeschichte als (Pop-)Produzent und mit dem Songmaterial, das er auf
„Milliontown“, „Experiments in Mass Appeal“ und
„Falling Satellites“ ablieferte – und sogar
darüber hinaus, wie er auf der 8-CD-Box „13 Winters“
bewies.
Zwei Fragen kreiseln mir nach dem ersten Hören im Kopf: wo sind
die Hooklines und wo ist John Mitchell? Und inwieweit haben diese
beiden Fragen miteinander zu tun? Aber Entwarnung: sowohl die einen als
auch der andere sind da. Nur besser eingebaut und erst bei genauerem
Hinhören erkennbar – soll meinen: Nehmt euch Zeit und
hört es ein paarmal öfter, es lohnt sich. Den Gesang
übernahm Godfrey dieses Mal wieder alleine, nachdem er
festgestellt hatte, dass er den auf den letzten beiden Alben mehr
und mehr an John Mitchell abgegeben hatte. Dabei war er doch eigentlich
selbst der ursprüngliche Frost*-Sänger. Mitchell war
unterdessen aber genauso beteiligt an den Songs wie auf den letzten
Alben. Wie bei einem Konzeptalbum üblich, hängen die Songs
zusammen, thematisch und auch soundtechnisch, das Grande Finale ist
dann schließlich der knapp 16minütige zweite Teil des
Titelstücks, hier dürfen sich die Instrumentalisten komplett
austoben, bauen ein paar tolle Genesis-Momente mit ein, wahnsinnig
gut!
Also: Wenn man das Album erst mal hat sacken lassen und ein paarmal
gehört hat, kann es nur eine Erkenntnis geben: Godfrey ist seinem
Anspruch gerecht geworden und hat hier ein Mega-Album erschaffen. Ob es
sein Magnus Opus ist, mag jeder für sich selbst entscheiden, denn
dafür waren die bisherigen Album Alben einfach schon zu
großartig, aber es steht definitiv auf einer Stufe mit seinen
Großtaten. Herzlichen Glückwunsch!
Für KW 41: LizZard - Mesh (Pelagic Records/Cargo)
 Ich
gebe zu, ich hatte diese Band bislang noch nicht auf dem Schirm, dabei
soll bereits ihr letztes Album „Eroded“ extrem gut gewesen
sein. Schlimmer noch: „Mesh“ ist bereits das fünfte
Album des französisch-englischen Trios. Was das Album so
interessant macht, ist, dass hier kein bestimmtes Genre angesprochen
wird, Katy Elwell (UK/Drums), Mat Ricou (FR/Guitar & Vocals) und
Will Knox (UK/Bass) rocken munter zwischen 90s Post-Punk und Artrock.
Die Promofirma sagt FFO (für Fans von) Tool, King Crimson,
Karnivool, Sparta, Radiohead, Deftones, Faith No More, Helmet, wobei
mir hier keine der Extreme untergekommen sind, die einige dieser Bands
ausspielen.
Ich
gebe zu, ich hatte diese Band bislang noch nicht auf dem Schirm, dabei
soll bereits ihr letztes Album „Eroded“ extrem gut gewesen
sein. Schlimmer noch: „Mesh“ ist bereits das fünfte
Album des französisch-englischen Trios. Was das Album so
interessant macht, ist, dass hier kein bestimmtes Genre angesprochen
wird, Katy Elwell (UK/Drums), Mat Ricou (FR/Guitar & Vocals) und
Will Knox (UK/Bass) rocken munter zwischen 90s Post-Punk und Artrock.
Die Promofirma sagt FFO (für Fans von) Tool, King Crimson,
Karnivool, Sparta, Radiohead, Deftones, Faith No More, Helmet, wobei
mir hier keine der Extreme untergekommen sind, die einige dieser Bands
ausspielen.
„Mesh“ ist eine spannende Mischung aus Alternative Rock
(#1) und melodischem Indie Rock (# 2,3). Dazu noch ein paar technische
Spielereien und melodische Breaks, da gibt es eine Menge zu
entdecken! Das wechselt zwischen U2 ähnlichen Rockstrukturen
und kräftigen Rock-Hymnen, und erinnert in seiner Abwechslung am
ehesten an The Intersphere, auch wenn hier keine klangliche Parallelen
zu finden sind. Nur vereinzelt darf es auch mal etwas komplexer werden.
So oder so, sie machen`s richtig gut. Im Dezember sind sie damit
auf Tournee (M, B, HH, K)
Für KW 40: Weather Systems - Ocean Without A Shore (Mascot)
Die Trennung von Anathema verlief geräuschlos. Zwar war Daniel
(Danny) Cavanagh zum Ende der Tournee eine große Müdigkeit
anzumerken, aber dass sich das auf die Band beziehen könnte, und
nicht dem monotonen Touralltag zuzuschreiben war, war an dieser Stelle
nicht erkennbar. (Das Interview findet ihr hier!) Nun also gehen die Brüder Cavanagh getrennte Wege. Vincent
hatte im August unter dem Namen The Radicant eine erste EP „We
Ascend“ veröffentlicht, die mit vier Songs relativ ruhig und
experimentell und nur im Song „Zero Blue“ wirklich
interessant ausgefallen ist und deswegen noch nicht wirklich Hinweise
gibt auf seine weitere musikalische Zukunft. Danny deutet schon mit der
Namenswahl seiner neuen Band eine Fortführung der alten an: „Weather Systems“ war der
Titel ihres 2012er Albums. Und in der Tat besitzt dieses Album alles,
was seine alte Band ausgemacht hat: ruhige Momente, Pianoläufe,
sphärische Phasen, große Rocksteigerungen und fantastische
Stimmungen, all das, was die Band in den letzten Jahren auf ihren Alben
zur Perfektion hat reifen lassen.
Fortführung der alten an: „Weather Systems“ war der
Titel ihres 2012er Albums. Und in der Tat besitzt dieses Album alles,
was seine alte Band ausgemacht hat: ruhige Momente, Pianoläufe,
sphärische Phasen, große Rocksteigerungen und fantastische
Stimmungen, all das, was die Band in den letzten Jahren auf ihren Alben
zur Perfektion hat reifen lassen.
Mit der portugiesische Sängerin Soraia hat er eine Duettpartnerin,
die stark an die von Anathema bekannte Lee Douglas erinnert. Und
während bereits der Opener dezent auf bekanntes Thema
zurückgreift, gibt es mit „Untouchable Part III“ sogar
noch eine offizielle Fortführung eines Bandklassikers. Er macht
also keinen Hehl daraus, wo er diese Band sieht. Man könnte so
weit gehen, zu sagen, dass man bei diesem Album unter dem Namen
Anathema vielleicht eine fehlende Weiterentwicklung beanstandet
hätte. Unter neuer Flagge fällt das unter Fanberuhigung. Die
freuen sich, dass das musikalische Erbe der Band weitergetragen wird.
Das gesagt gibt es zum Ende des Albums durchaus noch andere Töne:
Mit dem Titelsong scheint Danny fast einen kleinen Seitenhieb auf das
Projekt seines Bruders untergebracht zu haben, berührt es doch
deutlich die gleichen (oben erwähnten) Gefilde. Und das
abschließende „The Space Between Us“ ist zumindest
zum Anfang ungewöhnlich fröhlich und Pop-orientiert, bevor es
zum Ende noch einmal in bekannte Anathema-Rock-Richtung umschlägt.
Was bleibt, ist ein tolles neues Album, mit dem es so gerne weitergehen
darf, und einer Band, auf die man gespannt sein darf, ob sie, was sie
in Zukunft für Überraschungen parat hat.
Für KW 39: Dilemma - The Purpose Paradox (Butler Records, V2 / Bertus)
 Progressive
Rock ist diese Musikrichtung, bei der sich die Musiker gerne nach
Herzenslust austoben, Soli und Wechsel und Breaks einbauen, wo sie
eigentlich gar nicht gebraucht werden, und damit aus einem wunderbar
melodischen, harmonischen Popsong ein Stück Prog machen. Es gibt
allerdings nicht nur Musiker, die das mögen, sondern auch den
einen oder anderen Hörer, dem der durchschnittliche Rock-Sound
schlichtweg zu langweilig ist, und er ganz gerne auch Ecken und Kanten
in den Songs entdeckt. Manchmal ist es sogar notwendig, einen Song
mehrere Male zu hören, um ihn vollständig zu begreifen. Bei
den Niederländern Dilemma wird es mitunter ein bisschen komplexer,
"The Purpose Paradox" ist ihr drittes Album. Ein Album, das gar nicht
mal so richtig stark anfängt, dann aber v.a. im Mittelteil immer
besser wird. Und in der Tat bauen sie immer wieder mal ein Solo ein,
das dem Einen vielleicht zu viel abverlangt, dem Anderen dieses Album
aber erst richtig schmackhaft macht. In dem Sinne: viel Spaß!
Progressive
Rock ist diese Musikrichtung, bei der sich die Musiker gerne nach
Herzenslust austoben, Soli und Wechsel und Breaks einbauen, wo sie
eigentlich gar nicht gebraucht werden, und damit aus einem wunderbar
melodischen, harmonischen Popsong ein Stück Prog machen. Es gibt
allerdings nicht nur Musiker, die das mögen, sondern auch den
einen oder anderen Hörer, dem der durchschnittliche Rock-Sound
schlichtweg zu langweilig ist, und er ganz gerne auch Ecken und Kanten
in den Songs entdeckt. Manchmal ist es sogar notwendig, einen Song
mehrere Male zu hören, um ihn vollständig zu begreifen. Bei
den Niederländern Dilemma wird es mitunter ein bisschen komplexer,
"The Purpose Paradox" ist ihr drittes Album. Ein Album, das gar nicht
mal so richtig stark anfängt, dann aber v.a. im Mittelteil immer
besser wird. Und in der Tat bauen sie immer wieder mal ein Solo ein,
das dem Einen vielleicht zu viel abverlangt, dem Anderen dieses Album
aber erst richtig schmackhaft macht. In dem Sinne: viel Spaß!
Für KW 38: Anubis - The Unforgivable (Bird's Robe Records / MGM)
Das Besondere an diesem Album fällt einem eigentlich erst auf,
wenn mit „One Last Thing“, dem 5. Song des Albums, der ers te
langsamere, ruhigere Song beginnt. Bis dahin schaffen es die Australier
überraschenderweise, mit sehr viel Energie und erfrischendem Drive
vorzugehen. Was bei einer Musikrichtung, die so eng mit Pink Floyd
verwandt ist, durchaus ungewöhnlich ist. Umso schöner und
umso effektvoller ist dieser Song an dieser Stelle – und trotzdem
auch nur eine ruhige Zwischenstation, das folgende „All Because
of You“ legt schon wieder eine Schippe drauf. Trotzden gibt es
zweiten Teil des Albums auch die langsamere Seite wiederholt, aber das
ist bei dieser Musikrichtung durchaus passend und auch okay. „The
Unforgivable” ist zum 20. Bandjubiläum bereits das 3.
Konzeptalbum und ihr siebtes Studioalbum insgesamt. Und bislang
habe ich noch keine Schwachstelle in ihrer Diskografie ausmachen
können!
te
langsamere, ruhigere Song beginnt. Bis dahin schaffen es die Australier
überraschenderweise, mit sehr viel Energie und erfrischendem Drive
vorzugehen. Was bei einer Musikrichtung, die so eng mit Pink Floyd
verwandt ist, durchaus ungewöhnlich ist. Umso schöner und
umso effektvoller ist dieser Song an dieser Stelle – und trotzdem
auch nur eine ruhige Zwischenstation, das folgende „All Because
of You“ legt schon wieder eine Schippe drauf. Trotzden gibt es
zweiten Teil des Albums auch die langsamere Seite wiederholt, aber das
ist bei dieser Musikrichtung durchaus passend und auch okay. „The
Unforgivable” ist zum 20. Bandjubiläum bereits das 3.
Konzeptalbum und ihr siebtes Studioalbum insgesamt. Und bislang
habe ich noch keine Schwachstelle in ihrer Diskografie ausmachen
können!
Für KW 37: David Gilmour - Luck and Strange (Sony Music)
 Er
ist Kopf, Sänger und Gitarrist von Pink Floyd, da packt man noch
ein paar flächige Keyboards drunter und dann hat man noch alles
komplett, oder? So einfach ist das gar nicht – und ich
fürchte, das ist gar nicht David Gilmours musikalischer Anspruch
hier ein Pink Floyd Ersatzalbum zu erschaffen. Sein Ansatz ist ein
etwas anderer. Mehr Blues, mehr Song, mehr Erzählung. Dass das
kombiniert mit seiner fantastischen Gitarrenarbeit immer wieder
trotzdem auch nach Pink Floyd klingt, sollte eher als schöner
Nebeneffekt betrachtet werden. Er schreibt gute Songs und hat mit dem
Leadgesang und dem Harfenspiel von Romany Gilmour in „Between Two
Points“ sowie einigen Gastbeiträgen für nette
Abwechslung und Kontrastpunkte gesorgt. Und auf dem Titeltrack und
ersten Highlight ist sogar eine Aufnahme des verstorbenen Rick Wright
zu hören, die 2007 bei einer Jam Session in Davids Scheune
entstand. Und das abschließende „Scattered“ ist mit
seinem typischen Solo dann letztlich doch der Pink Floyd Moment des
Albums. Das alles reicht nicht ganz, um in Euphorie zu verfallen, hat
aber ein paar schöne Songs und strahlt eine wunderbare Ruhe aus,
hat aber durchaus auch kraftvolle Momente. Und die Tatsache, dass er
überhaupt mal wieder ein Album veröffentlicht, ist schon
mindestens eine Erwähnung wert. Dass es zudem deutlich mehr
Rockanteile hat als das seines Kollegen Mark Knopfler sorgt für
beide Daumen hoch!
Er
ist Kopf, Sänger und Gitarrist von Pink Floyd, da packt man noch
ein paar flächige Keyboards drunter und dann hat man noch alles
komplett, oder? So einfach ist das gar nicht – und ich
fürchte, das ist gar nicht David Gilmours musikalischer Anspruch
hier ein Pink Floyd Ersatzalbum zu erschaffen. Sein Ansatz ist ein
etwas anderer. Mehr Blues, mehr Song, mehr Erzählung. Dass das
kombiniert mit seiner fantastischen Gitarrenarbeit immer wieder
trotzdem auch nach Pink Floyd klingt, sollte eher als schöner
Nebeneffekt betrachtet werden. Er schreibt gute Songs und hat mit dem
Leadgesang und dem Harfenspiel von Romany Gilmour in „Between Two
Points“ sowie einigen Gastbeiträgen für nette
Abwechslung und Kontrastpunkte gesorgt. Und auf dem Titeltrack und
ersten Highlight ist sogar eine Aufnahme des verstorbenen Rick Wright
zu hören, die 2007 bei einer Jam Session in Davids Scheune
entstand. Und das abschließende „Scattered“ ist mit
seinem typischen Solo dann letztlich doch der Pink Floyd Moment des
Albums. Das alles reicht nicht ganz, um in Euphorie zu verfallen, hat
aber ein paar schöne Songs und strahlt eine wunderbare Ruhe aus,
hat aber durchaus auch kraftvolle Momente. Und die Tatsache, dass er
überhaupt mal wieder ein Album veröffentlicht, ist schon
mindestens eine Erwähnung wert. Dass es zudem deutlich mehr
Rockanteile hat als das seines Kollegen Mark Knopfler sorgt für
beide Daumen hoch!
Für KW 36: Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (InsideOutMusic/ Sony Music)
So sehr man sich an die Wandelbarkeit ihres Sounds gewöhnt hat, so sehr kann man doch feststellen, dass sie ihren ganz eigenen Sound gefunden haben und dem auch irgendwie
immer treu geblieben sind. Der war mit ihrem sensationellen
Debütalbum „The Dark Third“ 2005 noch so spannend,
dass man diesem Duo eine Riesenzukunft voraussagte. Im Folgenden wurde
mancher Fan aber durch die Verwandlungen ihres Sounds etwas
verunsichert: Weg vom Prog, hin zum Pop schien das Motto, weniger Rock,
weniger Soli, mehr Song, mehr Massenkompatibilität. Die Folge war
die zwischenzeitliche Auflösung der Band 2009-2018. Mit ihrer
Rückkehr und seit dem Album „Eupnea“ sind die
Rockelemente zurückgekehrt, die Eingängigkeit ist geblieben.
Die beschriebene prinzipielle Direktive gilt auch immer noch für
ihr neues, ihr sechstes Studioalbum. Ohne große Pop-Experimente,
mit toller Atmosphäre, tollen Songs, ein zur Perfektion gereifter
Duettgesang von Jon Courtney und Chloë Alper, ein paar kleinere
musikalische Spielereien, gerade genug, um nicht zu banal zu
erscheinen, aber eingängig genug, um auch auf großen
Bühnen zu funktionieren. Vielleicht liegt es an der Kollaboration
mit Musikern wie Guy Pratt oder Bruce Soord, dass manches an Kritiker-
und Fanlieblinge wie Pineapple Thief, Porcupine Tree oder Eloy
erinnert. Nicht zuletzt durch die längeren Songs „Bend the
Earth“ und „Lifeless Creature“ ein mega Album!
sie ihren ganz eigenen Sound gefunden haben und dem auch irgendwie
immer treu geblieben sind. Der war mit ihrem sensationellen
Debütalbum „The Dark Third“ 2005 noch so spannend,
dass man diesem Duo eine Riesenzukunft voraussagte. Im Folgenden wurde
mancher Fan aber durch die Verwandlungen ihres Sounds etwas
verunsichert: Weg vom Prog, hin zum Pop schien das Motto, weniger Rock,
weniger Soli, mehr Song, mehr Massenkompatibilität. Die Folge war
die zwischenzeitliche Auflösung der Band 2009-2018. Mit ihrer
Rückkehr und seit dem Album „Eupnea“ sind die
Rockelemente zurückgekehrt, die Eingängigkeit ist geblieben.
Die beschriebene prinzipielle Direktive gilt auch immer noch für
ihr neues, ihr sechstes Studioalbum. Ohne große Pop-Experimente,
mit toller Atmosphäre, tollen Songs, ein zur Perfektion gereifter
Duettgesang von Jon Courtney und Chloë Alper, ein paar kleinere
musikalische Spielereien, gerade genug, um nicht zu banal zu
erscheinen, aber eingängig genug, um auch auf großen
Bühnen zu funktionieren. Vielleicht liegt es an der Kollaboration
mit Musikern wie Guy Pratt oder Bruce Soord, dass manches an Kritiker-
und Fanlieblinge wie Pineapple Thief, Porcupine Tree oder Eloy
erinnert. Nicht zuletzt durch die längeren Songs „Bend the
Earth“ und „Lifeless Creature“ ein mega Album!
Für KW 35: Leprous - Melodies Of Atonement (InsideOutMusic / Sony Music )
 Irgendwann
packen sie dich. Mich hatten die Norweger um den schon sehr speziellen
Sänger Einar Solberg dieses Mal spätestens mit dem Song
„Starlight”, einem Song, der sie ungewohnt nah an Pink
Floyd bringt. Was letztlich etwas länger gedauert hat, als bei
ihren letzten Alben. Was allerdings am Eindruck lag, den sie bei mir
hinterlassen hatten… Ich war ja ehrlich gesagt schon etwas in
Sorge, dass ich nach dem relativ unbefriedigenden Konzert in Bremen die
Lust an der Band verloren hätte. Aber wenn man sich erst mal
wieder warm gehört hat, dann ist auch das neue, ihr achtes Album
wieder absolut gelungen. Waren Leprous eigentlich mal ne Metal Band?
Das ist ein Element in ihrem Sound, das mittlerweile recht selten zum
Tragen kommt, Growls gibt es nur ganz urz ein einem einziges Mal und
auch wenn viele der Songs rockige Ausbrüche beinhalten, gibt es
daneben auch sehr viele sehr ruhige Momente. Aber
wenn man sich drauf einlassen möchte und mit der Stimme klarkommt,
dann sind die einmal mehr absolut wunderbar.
Irgendwann
packen sie dich. Mich hatten die Norweger um den schon sehr speziellen
Sänger Einar Solberg dieses Mal spätestens mit dem Song
„Starlight”, einem Song, der sie ungewohnt nah an Pink
Floyd bringt. Was letztlich etwas länger gedauert hat, als bei
ihren letzten Alben. Was allerdings am Eindruck lag, den sie bei mir
hinterlassen hatten… Ich war ja ehrlich gesagt schon etwas in
Sorge, dass ich nach dem relativ unbefriedigenden Konzert in Bremen die
Lust an der Band verloren hätte. Aber wenn man sich erst mal
wieder warm gehört hat, dann ist auch das neue, ihr achtes Album
wieder absolut gelungen. Waren Leprous eigentlich mal ne Metal Band?
Das ist ein Element in ihrem Sound, das mittlerweile recht selten zum
Tragen kommt, Growls gibt es nur ganz urz ein einem einziges Mal und
auch wenn viele der Songs rockige Ausbrüche beinhalten, gibt es
daneben auch sehr viele sehr ruhige Momente. Aber
wenn man sich drauf einlassen möchte und mit der Stimme klarkommt,
dann sind die einmal mehr absolut wunderbar.
Für KW 34: MEER - Wheels Within Wheels (Karisma Records)
Ich versuche gerne, meine Gedanken über ein Album in einem Wort zusammenzufassen, was nicht immer gelingt. Aber bevor ich jetzt abschweife, können wir es hier
kurz machen: Spektakulär! Was die Norweger hier auf ihrem dritten
Album fabrizieren, trifft diese Bezeichnung fast durchgehend. Ein
ständiger, spielerischer Wechsel aus luftig leichten Popmelodien
und dramatischer Klangfülle ist schwerlich anders zu benennen. Das
beginnt mit dem Gesang, den sich Johanne und Knut Kippersund Nesdal
teilen, abwechsenlnd einzeln, zusammen oder gemeinsam mit weiteren
Bandmitgliedern im Chor, im kompletten Spektrum von ganz leise bis
maximal kraftvoll geschrien. Super. Das geht weiter über die
Instrumentierung von zart gezupften Gitarren über
reißerische Gitarrensoli bis zum kompletten Sinfonieorchester
gibt es hier ein ständiges Auf und Ab. Bis zu den Songs, die mal
langsam und im 4 Minuten Format bleiben bis zu den ausufern den Epen
bis zu knapp 10 Minuten. Ein bisschen wie Leprous ohne Metal-Elemente.
Oder wie Moon Safari mit noch mehr Tiefgang. Schon ihr zweites Album
„Playing House" vor drei Jahren brachte Medien und Fans
gleichermaßen zu Jubelstürmen, das wird Ihnen mit ihrem
neuen Album genauso gelingen. Eine Band, die auf vielen Bühnen zu
Hause ist, bislang aber vor allem im Progressive Rock abgefeiert wird.
Dabei ist ein weitaus größerer Hörerzirkel durchaus
denkbar und den acht zu wünschen.
immer gelingt. Aber bevor ich jetzt abschweife, können wir es hier
kurz machen: Spektakulär! Was die Norweger hier auf ihrem dritten
Album fabrizieren, trifft diese Bezeichnung fast durchgehend. Ein
ständiger, spielerischer Wechsel aus luftig leichten Popmelodien
und dramatischer Klangfülle ist schwerlich anders zu benennen. Das
beginnt mit dem Gesang, den sich Johanne und Knut Kippersund Nesdal
teilen, abwechsenlnd einzeln, zusammen oder gemeinsam mit weiteren
Bandmitgliedern im Chor, im kompletten Spektrum von ganz leise bis
maximal kraftvoll geschrien. Super. Das geht weiter über die
Instrumentierung von zart gezupften Gitarren über
reißerische Gitarrensoli bis zum kompletten Sinfonieorchester
gibt es hier ein ständiges Auf und Ab. Bis zu den Songs, die mal
langsam und im 4 Minuten Format bleiben bis zu den ausufern den Epen
bis zu knapp 10 Minuten. Ein bisschen wie Leprous ohne Metal-Elemente.
Oder wie Moon Safari mit noch mehr Tiefgang. Schon ihr zweites Album
„Playing House" vor drei Jahren brachte Medien und Fans
gleichermaßen zu Jubelstürmen, das wird Ihnen mit ihrem
neuen Album genauso gelingen. Eine Band, die auf vielen Bühnen zu
Hause ist, bislang aber vor allem im Progressive Rock abgefeiert wird.
Dabei ist ein weitaus größerer Hörerzirkel durchaus
denkbar und den acht zu wünschen.
Für KW 33: Frank Turner - Undefeated (Xtra Mile Recordings)
 Ein
Album, das fast an mir vorbeigegangen ist, dass ich fast verpasst
hätte. Was mit Turners neuer Unabhängigkeit zu tun hat
– weg vom Majorlabel, weg von den bekannten Vertriebswegen, back
to the roots. Wobei er seinem kleinen Label treu geblieben, also auch
nicht wirklich bei Null anfängt. Und als ich begann,
reinzuhören war mein erster Eindruck noch, dass das mit dem
„vorbeigegangen“ gar nicht so schlimm gewesen wäre.
Sein letztes Album gehört zwar zu den Highlight Alben 2022, das
neue beginnt aber überraschend rau und ruppig. Immerhin hat er ja
auch eine Punk Vergangenheit, das kehrt er auch auf diesen neuen Album
wiederholt hervor. Beginnend aber mit Song 3, „Ceasefire“
(Waffenstillstand), einem Song, der dir schlichtweg die Socken
auszieht, beginnt dieses Album immer interessanter zu werden. OK, Songs
wie dieser eine Kandidat für die Liste der Highlights 24 gibt es
nicht so sehr viele, streng genommen mit „Somewhere
Inbetween“ nur einen, aber mit „Letters“, dem
Titelsong und ein paar weiteren gibt es gute Songs – und wenn man
sich erstmal an den ruppigeren Sound des Albums gewöhnt hat,
beginnt es auch immer mehr Spaß zu machen.
Ein
Album, das fast an mir vorbeigegangen ist, dass ich fast verpasst
hätte. Was mit Turners neuer Unabhängigkeit zu tun hat
– weg vom Majorlabel, weg von den bekannten Vertriebswegen, back
to the roots. Wobei er seinem kleinen Label treu geblieben, also auch
nicht wirklich bei Null anfängt. Und als ich begann,
reinzuhören war mein erster Eindruck noch, dass das mit dem
„vorbeigegangen“ gar nicht so schlimm gewesen wäre.
Sein letztes Album gehört zwar zu den Highlight Alben 2022, das
neue beginnt aber überraschend rau und ruppig. Immerhin hat er ja
auch eine Punk Vergangenheit, das kehrt er auch auf diesen neuen Album
wiederholt hervor. Beginnend aber mit Song 3, „Ceasefire“
(Waffenstillstand), einem Song, der dir schlichtweg die Socken
auszieht, beginnt dieses Album immer interessanter zu werden. OK, Songs
wie dieser eine Kandidat für die Liste der Highlights 24 gibt es
nicht so sehr viele, streng genommen mit „Somewhere
Inbetween“ nur einen, aber mit „Letters“, dem
Titelsong und ein paar weiteren gibt es gute Songs – und wenn man
sich erstmal an den ruppigeren Sound des Albums gewöhnt hat,
beginnt es auch immer mehr Spaß zu machen.
Für KW 32: Blues Pills - Birthday (BMG Rights Management)
Sie galten mal als die heißeste Band des Retro Rock, mit
Betonung auf Retro Rock. Und „heiß“ bezog sich nicht
zuletzt auf Sängerin Elin Larsson, bei der ich im Konzert erstmalig ein
schlechtes Gewissen hatte, so ein unmittelbar nah vor ihr im Fotograben
zu stehen, während sie in ultrakurzen Mini im Kopfhöhe eine
Mega-Performance hinterlegte… aber zurück zum Thema.
Bereits mit ihrem letzten Album „Holy Moly“ hatten sie nach
dem Ausstieg ihres Gitarristen Dorian Sorriaux einen leicht
veränderten Sound vorgelegt, waren deutlich geradliniger geworden,
hatte aber noch genügend musikalische Feinheiten abgeliefert, um
sie als Rockband zu bezeichnen. Ihr neues Album wird der Einordnung
unter Retro Rock nicht mehr wirklich gerecht. Während Elin mit
ihrer kraftvollen Stimme wiederholt an Adele erinnert, ist auch das,
was ihre Mitstreiter so an Songs zeigen, auch nicht so sehr weit davon
entfernt. Und wie es bereits im Opener heißt „I do what I
want“, stellt Elin von Anfang an klar, dass sie sich nicht an die
Erwartungshaltung ihrer Fans oder von irgendjemandem sonst
unterwerfen möchte. Und ohne die letzten Adele Alben als Ganzes
gehört zu haben, haben zumindest die Blues Pills immer noch
genügend Rock im Sound, dass sich kaum jemand genervt weg drehen
dürfte. Und wenn Ihnen mit diesen Schritt in den Mainstream
gelingt, so what? Klasse Abwechslung, klasse Songs, eine grandiose
Sängerin, hört mal rein!
auf Sängerin Elin Larsson, bei der ich im Konzert erstmalig ein
schlechtes Gewissen hatte, so ein unmittelbar nah vor ihr im Fotograben
zu stehen, während sie in ultrakurzen Mini im Kopfhöhe eine
Mega-Performance hinterlegte… aber zurück zum Thema.
Bereits mit ihrem letzten Album „Holy Moly“ hatten sie nach
dem Ausstieg ihres Gitarristen Dorian Sorriaux einen leicht
veränderten Sound vorgelegt, waren deutlich geradliniger geworden,
hatte aber noch genügend musikalische Feinheiten abgeliefert, um
sie als Rockband zu bezeichnen. Ihr neues Album wird der Einordnung
unter Retro Rock nicht mehr wirklich gerecht. Während Elin mit
ihrer kraftvollen Stimme wiederholt an Adele erinnert, ist auch das,
was ihre Mitstreiter so an Songs zeigen, auch nicht so sehr weit davon
entfernt. Und wie es bereits im Opener heißt „I do what I
want“, stellt Elin von Anfang an klar, dass sie sich nicht an die
Erwartungshaltung ihrer Fans oder von irgendjemandem sonst
unterwerfen möchte. Und ohne die letzten Adele Alben als Ganzes
gehört zu haben, haben zumindest die Blues Pills immer noch
genügend Rock im Sound, dass sich kaum jemand genervt weg drehen
dürfte. Und wenn Ihnen mit diesen Schritt in den Mainstream
gelingt, so what? Klasse Abwechslung, klasse Songs, eine grandiose
Sängerin, hört mal rein!
Für KW 31: Benjamin Croft - We Are Here to Help
 Der
Keyboarder, Produzent und Songwriter Benjamin Croft legt sein drittes
Album vor, einmal mehr mit diversen prominenten Gästen besetzt.
Und die dürfen erst einmal die Muskeln spielen lassen: Im
siebenminütigen instrumentalen Opener dürfen erst mal die
Instrumentallisten ihre Fähigkeiten zeigen, und die heißen
neben Croft u.a. Marco Minnemann und Greg Howe, an anderer Stelle auch
Simon Phillips, Stuart Hamm, Billy Sheehan oder Frank Gambale. Danach
schlägt das Album einen mehr songorientierten Weg ein: Das
Titelstück erinnert dann stark an Asia, stimmlich getragen vom
klasse Sänger Jeff Scott Soto; ein toller Song! Von den acht Songs
haben vier Gesang, entweder von Soto oder von der Sängerin Lynsey
Ward, die ebenfalls einen tollen Job macht, mir persönlich aber
nicht ganz so liegt wie Soto. Aber eine tolle Idee, so bleibt es
abwechslungsreich und interessant, v.a. für Leute, die nicht so
sehr auf reine Instrumentalalben stehen. Es bleibt beim Wechselspiel
zwischen instrumentalen Ausflügen, die mal mehr, mal weniger
einzigartig sind, und Stücken mit Gesang, wobei die Songs mit Soto
etwas anspruchsvoller arrangiert sind. Ein spannender Wechsel aus
Anspruch und Eingängigkeit, Rock und Prog.
Der
Keyboarder, Produzent und Songwriter Benjamin Croft legt sein drittes
Album vor, einmal mehr mit diversen prominenten Gästen besetzt.
Und die dürfen erst einmal die Muskeln spielen lassen: Im
siebenminütigen instrumentalen Opener dürfen erst mal die
Instrumentallisten ihre Fähigkeiten zeigen, und die heißen
neben Croft u.a. Marco Minnemann und Greg Howe, an anderer Stelle auch
Simon Phillips, Stuart Hamm, Billy Sheehan oder Frank Gambale. Danach
schlägt das Album einen mehr songorientierten Weg ein: Das
Titelstück erinnert dann stark an Asia, stimmlich getragen vom
klasse Sänger Jeff Scott Soto; ein toller Song! Von den acht Songs
haben vier Gesang, entweder von Soto oder von der Sängerin Lynsey
Ward, die ebenfalls einen tollen Job macht, mir persönlich aber
nicht ganz so liegt wie Soto. Aber eine tolle Idee, so bleibt es
abwechslungsreich und interessant, v.a. für Leute, die nicht so
sehr auf reine Instrumentalalben stehen. Es bleibt beim Wechselspiel
zwischen instrumentalen Ausflügen, die mal mehr, mal weniger
einzigartig sind, und Stücken mit Gesang, wobei die Songs mit Soto
etwas anspruchsvoller arrangiert sind. Ein spannender Wechsel aus
Anspruch und Eingängigkeit, Rock und Prog.
Für KW 30: Deep Purple =1 (EAR Music)
Wie schafft man als Altherrenriege, immer noch relevant und auch für jüngere Hörer noch interessant zu bleiben? Wie schaffen es Deep Purple, nach so vielen Jahren immer noch Alben zu
produzieren, die sich zwar auf ihren typischen Trademark-Sound
stützen, aber trotzdem zeitgemäß sind? Liegt es an den
immer wieder neuen Gitarristen, die neues Blut, neue Ideen, neuen Drive
mit reinbringen? Während ich diese Frage zunächst noch
abwegig finde und es auch auf dem neuen Album wieder einige Songs gibt,
die wirklich gelungen und richtig gut sind, ist es bei den meisten
Songs dann doch in der Tat das Gitarrensolo, was am meisten
heraussticht und die durch seinen neuen Sound dem oben angesprochenen
Jungbrunnen am meisten ausmacht. Was Simon McBride als aktuellster
Neuzugang zwischen Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice und Don Airey
hier abliefert, macht so einen Spaß und klingt so gut, dass es
selbst die unwichtigeren Songs aufgewertet. Und auch die gibt es.
Trotzdem: mal wieder alles richtig gemacht, Wechsel gelungen, Album
gelungen.
Wie schaffen es Deep Purple, nach so vielen Jahren immer noch Alben zu
produzieren, die sich zwar auf ihren typischen Trademark-Sound
stützen, aber trotzdem zeitgemäß sind? Liegt es an den
immer wieder neuen Gitarristen, die neues Blut, neue Ideen, neuen Drive
mit reinbringen? Während ich diese Frage zunächst noch
abwegig finde und es auch auf dem neuen Album wieder einige Songs gibt,
die wirklich gelungen und richtig gut sind, ist es bei den meisten
Songs dann doch in der Tat das Gitarrensolo, was am meisten
heraussticht und die durch seinen neuen Sound dem oben angesprochenen
Jungbrunnen am meisten ausmacht. Was Simon McBride als aktuellster
Neuzugang zwischen Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice und Don Airey
hier abliefert, macht so einen Spaß und klingt so gut, dass es
selbst die unwichtigeren Songs aufgewertet. Und auch die gibt es.
Trotzdem: mal wieder alles richtig gemacht, Wechsel gelungen, Album
gelungen.
Für KW 29: SYLVAN – Back to Live (GAOM/Soulfood)
 Manchmal
können Alben ja auch Trostpflaster sein. Wer am letzten Wochenende
beim finalen Night of the Prog Festival (schnief!...) dabei war, wird
sich von den
Live-Qualitäten der Hamburger überzeugt (und sich
wahrscheinlich sofort danach dieses Album zugelegt) haben. Für
alle anderen kommt die Empfehlung auf diesem Weg. Was die fünf
hier abfeiern, unterstreicht ihren Ausnahmestatus in der deutschen
Szene. Nicht nur dass sie ein wunderbares Rundumpaket aus ihren Alben
schnürt haben, sie belassen es auch selten bei den Studio
Versionen. Vor allem Gitarrist Johnny Beck sticht immer wieder hervor
mit fantastischen Gilmour-Soli und schlägt daneben wiederholt auch
deutlich
kräftiger an als auf den Studioversionen, was die herrlichen
Keyboardflächen wunderbar kontrastiert. Sänger Marco
Glühmann zieht da mit mehr Power in der Stimme
locker mit. Das geht los mit seinem Freudenschrei im ersten Song, der
ausdrückt, wie froh sie sind, wieder auf der Bühne zu stehen,
geht über mehrere kraftvolle Auszüge aus dem aktuellen Album
„One to Zero“, über vier- bis 13-minütige Songs
und hält an bis zum überragenden „Posthumous
Silence“-Finale. 92 Minuten, die viel zu schnell vorbei sind.
(Auch als DVD erhältlich!)
Manchmal
können Alben ja auch Trostpflaster sein. Wer am letzten Wochenende
beim finalen Night of the Prog Festival (schnief!...) dabei war, wird
sich von den
Live-Qualitäten der Hamburger überzeugt (und sich
wahrscheinlich sofort danach dieses Album zugelegt) haben. Für
alle anderen kommt die Empfehlung auf diesem Weg. Was die fünf
hier abfeiern, unterstreicht ihren Ausnahmestatus in der deutschen
Szene. Nicht nur dass sie ein wunderbares Rundumpaket aus ihren Alben
schnürt haben, sie belassen es auch selten bei den Studio
Versionen. Vor allem Gitarrist Johnny Beck sticht immer wieder hervor
mit fantastischen Gilmour-Soli und schlägt daneben wiederholt auch
deutlich
kräftiger an als auf den Studioversionen, was die herrlichen
Keyboardflächen wunderbar kontrastiert. Sänger Marco
Glühmann zieht da mit mehr Power in der Stimme
locker mit. Das geht los mit seinem Freudenschrei im ersten Song, der
ausdrückt, wie froh sie sind, wieder auf der Bühne zu stehen,
geht über mehrere kraftvolle Auszüge aus dem aktuellen Album
„One to Zero“, über vier- bis 13-minütige Songs
und hält an bis zum überragenden „Posthumous
Silence“-Finale. 92 Minuten, die viel zu schnell vorbei sind.
(Auch als DVD erhältlich!)Für KW 28: Rendezvous Point - Dream Chaser (Long Branch Records / SPV)
Ich muss auf den Anfang meiner Review zum Album von Caligula`s Horse, „Charcoal Grace“ (KW 4) zurückkommen,  die
da genannte Zahl der Bands von vier auf fünf erhöhen und um
Rendezvous Point erweitern: Auch die Norweger machen ihre Sache auf
ihrem dritten Album extrem gut. Spannender Prog Metal zwischen
Hookline, Breaks und Taktwechsel. Immer wieder überraschend, aber
trotzdem eingängig. Gut gemacht! Abwechslungsreiche Songs, geniale
Breaks und Tempowechsel, tolle Hooklines, grandiose Soli und noch ein
paar symphonische Elemente im abschließenden „Still
Water“. Das Quintett um Leprous-Schlagzeuger Baard Kolstad
erzeugt viel Spannung und liefert ab. Ein tolles Album, mit dem sie,
wie eingangs erwähnt, in die Riege der Bands Haken, Teramaze, Soen
und Caligula´s Horse aufsteigen, ohne ihnen dabei irgendwie zu
nahe zu kommen. Ganz im Gegenteil, jede der genannten Bands hat ihre
ganz eigenen Qualitäten. Bei Rendevous Point kommt mir zudem auch
The Intersphere wiederholt in den Sinn.
die
da genannte Zahl der Bands von vier auf fünf erhöhen und um
Rendezvous Point erweitern: Auch die Norweger machen ihre Sache auf
ihrem dritten Album extrem gut. Spannender Prog Metal zwischen
Hookline, Breaks und Taktwechsel. Immer wieder überraschend, aber
trotzdem eingängig. Gut gemacht! Abwechslungsreiche Songs, geniale
Breaks und Tempowechsel, tolle Hooklines, grandiose Soli und noch ein
paar symphonische Elemente im abschließenden „Still
Water“. Das Quintett um Leprous-Schlagzeuger Baard Kolstad
erzeugt viel Spannung und liefert ab. Ein tolles Album, mit dem sie,
wie eingangs erwähnt, in die Riege der Bands Haken, Teramaze, Soen
und Caligula´s Horse aufsteigen, ohne ihnen dabei irgendwie zu
nahe zu kommen. Ganz im Gegenteil, jede der genannten Bands hat ihre
ganz eigenen Qualitäten. Bei Rendevous Point kommt mir zudem auch
The Intersphere wiederholt in den Sinn.
Für KW 27: Airbag - The Century of the Self (Karisma Records)
 Die
Norweger sind ein wenig entspannter geworden, was die
Veröffentlichungsrhythmen ihrer neuen Alben betrifft. Seit
Gitarrist Bjørn Riis auch Soloalben veröffentlicht,
scheinen die Songideen besser aufgeteilt zu werden. Was am
musikalischen Grundkonzept der Band nicht viel geändert hat: Sie
stehen immer noch, ebenso entspannt, für erstklassig ausgefeilte
Komposition im Klangkosmos von Pink Floyd, wiederholt unterbrochen
durch ein paar lautere, bzw. härtere Elemente, was sie in die
unmittelbaren Nähe von Bruce Soords Pineapple Tief bringt. Und das
steht ihnen ausgezeichnet! Fünf Songs gibt es nur, alle über
5 Minuten, in der Spitze bis zu 15 Minuten. Allesamt verfeinert durch
flächige Keyboardsounds und markante Gitarren, die immer wieder
auf an David Gilmour erinnern. Der geneigte Fan wird es lieben,
spektakulär neu ist auf diesem Album nichts, aber durch den
Abwechslungsreichtum und die lauteren Elemente ein Album, mit dem man
wenig falsch machen kann.
Die
Norweger sind ein wenig entspannter geworden, was die
Veröffentlichungsrhythmen ihrer neuen Alben betrifft. Seit
Gitarrist Bjørn Riis auch Soloalben veröffentlicht,
scheinen die Songideen besser aufgeteilt zu werden. Was am
musikalischen Grundkonzept der Band nicht viel geändert hat: Sie
stehen immer noch, ebenso entspannt, für erstklassig ausgefeilte
Komposition im Klangkosmos von Pink Floyd, wiederholt unterbrochen
durch ein paar lautere, bzw. härtere Elemente, was sie in die
unmittelbaren Nähe von Bruce Soords Pineapple Tief bringt. Und das
steht ihnen ausgezeichnet! Fünf Songs gibt es nur, alle über
5 Minuten, in der Spitze bis zu 15 Minuten. Allesamt verfeinert durch
flächige Keyboardsounds und markante Gitarren, die immer wieder
auf an David Gilmour erinnern. Der geneigte Fan wird es lieben,
spektakulär neu ist auf diesem Album nichts, aber durch den
Abwechslungsreichtum und die lauteren Elemente ein Album, mit dem man
wenig falsch machen kann.
Für KW 26: Kilbey Kennedy - Premonition K
Steve Kilbeys erfolgreichste Zeit war in den späten Achtzigern und frühen Neunzigern - -mit The Church ab dem Hit "Under the Milky Way" und dem dazugehörigen Album "Starfish". Bei
mir so erfolgreich, dass ich anschließend versucht habe,
seine Solokarriere mit aufzuarbeiten - was aber recht schwierig war,
denn es gab bereits eine etwas unübersichtliche Anzahl von Alben,
die zudem aufgrund der Entfernung zu Australien hierzulande relativ
schwierig zu besorgen waren. So bin ich über „The Red
Eye“ nicht hinausgekommen - glücklicherweise, muss man im
Nachhinein wohl sagen, wenn man mein 2004er Interview mit Kilbey richtig deutet...
"Under the Milky Way" und dem dazugehörigen Album "Starfish". Bei
mir so erfolgreich, dass ich anschließend versucht habe,
seine Solokarriere mit aufzuarbeiten - was aber recht schwierig war,
denn es gab bereits eine etwas unübersichtliche Anzahl von Alben,
die zudem aufgrund der Entfernung zu Australien hierzulande relativ
schwierig zu besorgen waren. So bin ich über „The Red
Eye“ nicht hinausgekommen - glücklicherweise, muss man im
Nachhinein wohl sagen, wenn man mein 2004er Interview mit Kilbey richtig deutet...
Seine Kollaboration mit Martin Kennedy ist nicht ganz neu, trotzdem
hatte ich die beiden etwas aus den Augen verloren. Umso schöner
die Überraschung, als ich von dem neuen Album hörte.
Insbesondere umso schöner die Feststellung, dass hier immer noch
vieles beim alten, sprich zum Guten ist. Das trifft beim neuen Album
vor allem auf die ersten 3,4 Songs zu, die durch eine wunderbare
Mischung aus akustischer Gitarre und Gitarrensoli gewisse Pink
Floyd-Parallelen aufweisen. Aber auch sonst können die einzelnen
Songs durchaus überzeugen. Allerdings machen die beiden es sich
etwas einfach, denn die beiden bleiben eigentlich durchgehend im
moderaten Slow Mode, was ist beim ersten Hören einfach leicht
macht, die Songs zu mögen. denn letztlich fehlt die Abwechslung.
Rocksongs wie "Reptile" vom besagten Starfish -Album fehlt hier
gänzlich, vom Hitformat wie "Under the Milky Way" ganz zu
schweigen, aber ich glaube da möchte Kilbey auch gar nicht wieder
hin. Fazit: schön, dass er wieder da ist beziehungsweise
schön, dass ich ihn wieder entdeckt habe, aber spektakulär
wäre etwas anderes.
Für KW 25: Marco Glühmann – A Fragile Present (Gentle Art Of Music/Soulfood)
 So
bringt man seinen Namen auch bei denen ins Gespräch, die nicht die
Minibooklets der CDs bzw. das Kleingedruckte in den Downloads lesen. :-) Also: Hand aufs Herz: Wer wusste, dass MArco Glühmann Sänger der Hamburger Artrocker Sylvan ist?
So
bringt man seinen Namen auch bei denen ins Gespräch, die nicht die
Minibooklets der CDs bzw. das Kleingedruckte in den Downloads lesen. :-) Also: Hand aufs Herz: Wer wusste, dass MArco Glühmann Sänger der Hamburger Artrocker Sylvan ist?
Aber Ehre, wem Ehre gebührt: Er kann’s
alleinverantwortlich fast genauso gut. Streng genommen, kann er es
genauso gut. Denn verglichen mit dem 2006er
Sylvan-Album „Presets“, das die Band immer ihr Pop-,
bzw. Frauenalbum genannt haben, schneidet dieses Album mindestens
genauso gut ab. Schon durch die Stimme extrem ähnlich, hat er sich
auch im Songwriting genügend abgeschaut, um den Stil seiner Band
sehr nahe zu kommen. Lediglich auf lange Instrumentalparts verzichtet
er größtenteils, hält das Album eher songdienlich, aber
die Songs haben es trotzdem in sich. Abwechslungsreich, mal langsam,
mal energetisch, besitzen Sie einige Qualitäten. Übrigens:
Allein ist Glühmann natürlich nicht, ganz im Gegenteil: Mit
Kalle Wallner, Yogi Lang und Markus Grützner hat er fast die
gesamte Band RPWL als Unterstützung, alternativ auch Johnny Beck
(Sylvan) und Steve Rothery (Marillion) und Billy Sherwood (Yes) als
Gastmusiker dabei. Trotzdem bleiben für ihn noch Gesang, Keyboards
und Gitarren. Ein tolles Album!
Für KW 24: OK KID - Endlich wieder da wo es beginnt (Epic Records Germany / Sony Music)
Und wenn wir schon bei verspätet vorgestellten Alben sind, dabei ist (noch) gar keine Sommerpause): Ein Album zum zehnten Geburtstag. Und der Name verspricht einiges! Fertiggestellt zum 5.
Geburtstag ihres eigenen Festivals in ihrer eigenen „Stadt ohne
Meer“, veröffentlicht letztlich doch ein wenig später,
ein Hybrid aus Vergangenheit und Zukunft. Neue Songs,
überraschende Kollabos und Klassiker im neuen Soundgewand. Nachdem
viel zu lange (unfreiwillig, u.a. wegen Corona) auf Pause gedrückt
werden musste, sollte es mehr als ein Jubiläum sein. Ein
kompletter Neubeginn. „Wir wollen uns nicht daran messen, was wir
bisher geschaffen haben, sondern an dem, was wir noch schaffen
können.", schreibt die Band auf ihren sozialen Netzwerken. Im
April eine erste Tour dazu – aber bereits vor dem zweiten Teil im
Juni scheint wieder Schluss zu sein! „Wir lösen uns nicht
auf“, sagt Jonas beim Konzert im Mojo, Hamburg. „Wir machen
eine Pause. Aber wir kommen zurück“. Das ging jetzt etwas
schneller als erwartet und erhofft. Aber die Zwischenzeit
versüßen wir uns mit diesem Dutzend. Mit einem
Rückblick auf Jonas Highlights als Zauberer der Worte inklusive
neuer Meilensteine. Und (u.a. Orchester-)Versionen zum Dahinschmelzen.
Bleibt nicht zu lange weg, Jungs (plus neu: Bassmädel)!
Geburtstag. Und der Name verspricht einiges! Fertiggestellt zum 5.
Geburtstag ihres eigenen Festivals in ihrer eigenen „Stadt ohne
Meer“, veröffentlicht letztlich doch ein wenig später,
ein Hybrid aus Vergangenheit und Zukunft. Neue Songs,
überraschende Kollabos und Klassiker im neuen Soundgewand. Nachdem
viel zu lange (unfreiwillig, u.a. wegen Corona) auf Pause gedrückt
werden musste, sollte es mehr als ein Jubiläum sein. Ein
kompletter Neubeginn. „Wir wollen uns nicht daran messen, was wir
bisher geschaffen haben, sondern an dem, was wir noch schaffen
können.", schreibt die Band auf ihren sozialen Netzwerken. Im
April eine erste Tour dazu – aber bereits vor dem zweiten Teil im
Juni scheint wieder Schluss zu sein! „Wir lösen uns nicht
auf“, sagt Jonas beim Konzert im Mojo, Hamburg. „Wir machen
eine Pause. Aber wir kommen zurück“. Das ging jetzt etwas
schneller als erwartet und erhofft. Aber die Zwischenzeit
versüßen wir uns mit diesem Dutzend. Mit einem
Rückblick auf Jonas Highlights als Zauberer der Worte inklusive
neuer Meilensteine. Und (u.a. Orchester-)Versionen zum Dahinschmelzen.
Bleibt nicht zu lange weg, Jungs (plus neu: Bassmädel)!
Für KW 23: The Smile - Wall Of Eyes (Label: XL Recordings)
Nachdem ihr Album zur Veröffentlichung im Januar irgendwie
unter den Tisch gefallen ist, nutzen wir ihr anstehendes Konzert in
Hamburger Stadtpark am Samstag, 8. Juni (6 weitere Konzerte in
Deutschland folgen bis August), um darauf zurückzukommen.
 Von
einem Radiohead(Rh)-Seitenprojekt kann man hier eigentlich schon gar
nicht mehr reden, denn während es um Thom Yorkes erstes Baby seit
2016 (Studio-)still ist, ist „Wall Of Eyes“ bereits
das zweite The Smile Album. Ein Trio, pandemiebedingt entstanden mit
Rh-Gitarrist Jonny Greenwood und dem neuen Mann an den Drums, Tom
Skinner, eigentlich eher in der Londoner Avantgarde-Jazz-Szene
beheimatet. Während auf den ersten Blick vieles an Rh erinnern
mag, ist das letztlich v.a. der verschwurbelte Gesang Yorkes sowie die
eher ruhige Stimmung und flirrende Elektronicssounds, die jetzt aber
auch nicht so Rh-exklusiv sind. Ansonsten geben sich The Smile sehr
abwechslungsreich und v.a. wiederholt psychedelisch (es gab zur Band
schon sehr früh Can-Vergleiche). Zwischendurch werden sie (in der
zweiten Single) „Friend Of A Friend“ auch mal simpel und
songorientierter, The Verve lassen grüßen, und gerade wenn
man noch ergänzen möchte: eher unspektakulär,
hauen sie mit „Bending Hectic“ einen Knaller raus. Der
Gitarrenstimmsong, möchte man ihn nennen (wie genial ist das, die
Gitarre während der Aufnahme zu stimmen?!), mit Harmonien zum
Sterben schön. Und dann als wäre das nicht schon genug,
schalten sie im zweiten Teil auf Rocksong um, wie man es seit ihrem
93er Debüt „Pablo Honey“ nicht mehr gehört hat.
Whouwh! Ein Meisterwerk. Und selbst wenn das die große Ausnahme
auf diesem Album bleibt, fragt man sich ob sie sich diese Sounds unter
ihrem alten Bandnamen auch getraut hätten, wohl wissend dass sie
als Rh ein Vielfaches verdienen könnten. Was bei Ihnen
natürlich kein Maßstab ist, also müsste man wohl eher
sagen ein Vielfaches an Aufmerksamkeit erregen. The Smile hat bei
Deezer 19.464, Rh knapp 3,5M Fans. Noch Fragen?
Von
einem Radiohead(Rh)-Seitenprojekt kann man hier eigentlich schon gar
nicht mehr reden, denn während es um Thom Yorkes erstes Baby seit
2016 (Studio-)still ist, ist „Wall Of Eyes“ bereits
das zweite The Smile Album. Ein Trio, pandemiebedingt entstanden mit
Rh-Gitarrist Jonny Greenwood und dem neuen Mann an den Drums, Tom
Skinner, eigentlich eher in der Londoner Avantgarde-Jazz-Szene
beheimatet. Während auf den ersten Blick vieles an Rh erinnern
mag, ist das letztlich v.a. der verschwurbelte Gesang Yorkes sowie die
eher ruhige Stimmung und flirrende Elektronicssounds, die jetzt aber
auch nicht so Rh-exklusiv sind. Ansonsten geben sich The Smile sehr
abwechslungsreich und v.a. wiederholt psychedelisch (es gab zur Band
schon sehr früh Can-Vergleiche). Zwischendurch werden sie (in der
zweiten Single) „Friend Of A Friend“ auch mal simpel und
songorientierter, The Verve lassen grüßen, und gerade wenn
man noch ergänzen möchte: eher unspektakulär,
hauen sie mit „Bending Hectic“ einen Knaller raus. Der
Gitarrenstimmsong, möchte man ihn nennen (wie genial ist das, die
Gitarre während der Aufnahme zu stimmen?!), mit Harmonien zum
Sterben schön. Und dann als wäre das nicht schon genug,
schalten sie im zweiten Teil auf Rocksong um, wie man es seit ihrem
93er Debüt „Pablo Honey“ nicht mehr gehört hat.
Whouwh! Ein Meisterwerk. Und selbst wenn das die große Ausnahme
auf diesem Album bleibt, fragt man sich ob sie sich diese Sounds unter
ihrem alten Bandnamen auch getraut hätten, wohl wissend dass sie
als Rh ein Vielfaches verdienen könnten. Was bei Ihnen
natürlich kein Maßstab ist, also müsste man wohl eher
sagen ein Vielfaches an Aufmerksamkeit erregen. The Smile hat bei
Deezer 19.464, Rh knapp 3,5M Fans. Noch Fragen?
Wie auch immer, nehmen wir beide Bands einfach nebeneinander, freuen uns über ein gutes, abwechslungsreiches Album, mit einem spektakulären Ausnahmesong on top und schauen mal wie es weitergeht.
Für KW 22: Matt Page - Apocalypse Garden
An der Seite von Drummer Joey Waters und Bassist Chris Tackett ist Page der Gitarrist und Sänger Teil des genialen Trios Dream The Electric Sleep, die uns in unregelmäßigen
Abständen mit Monsteralben im Wall-of-Sound-Breitwandformat
begeistern. Die letzte Platte „American Mystic“ liegt rund
ein Jahr zurück. Anfang des Jahres begann Page dann, erste
Häppchen aus seinem ersten Soloalbum „Apocalypse
Garden“ zu veröffentlichen. Und bereits „The
Turning” war ein kleines Highlight, im März folgte mit
„Massive Stars“ ein weiteres, bevor „Waiting for a
Return“ die Vorfreude schon extrem steigerte: Neben
„Chasing the Sun“ eins der Highlights des Albums, das
mittlerweile veröffentlicht ist, zumindest aus Sicht des Dream The
Electric Sleep-Fans. Denn wie es sich für ein Soloalbum
gehört, schlägt das Album nicht in dieselbe Kerbe seiner
Band. Ganz so extrem wie Page es selbst beschreibt, nämlich als
eine Mischung aus Alternative Rock meets Progressive Pop meets Folk
Americana würde ich es, v.a. was den letzten Teil betrifft, nicht
bezeichnen, aber es ist schon weniger Wall of Sound. Don Henley,
Kansas, Asia und Peter Gabriel oder aber die Spät-Achziger Simple
Minds wären mögliche Orientierungshilfen, ohne jetzt direkte
Vergleichsmöglichkeiten unterstellen zu wollen. Die Musik und
Texte von „Apocalypse Garden“ wurden komplett von Page
allein geschrieben, zudem spielte der Sänger aus Kentucky Gitarre,
Bass, Keyboards und Drums alleine ein. Produzent, der er ist,
übernahm er auch gleich die Produktion, lediglich für den Mix
nahm er die Hilfe von Nathan Yarborough in Anspruch. Ein Album, das in
einer gerechten Welt durchaus einige Wellen schlagen würde!
Dream The Electric Sleep, die uns in unregelmäßigen
Abständen mit Monsteralben im Wall-of-Sound-Breitwandformat
begeistern. Die letzte Platte „American Mystic“ liegt rund
ein Jahr zurück. Anfang des Jahres begann Page dann, erste
Häppchen aus seinem ersten Soloalbum „Apocalypse
Garden“ zu veröffentlichen. Und bereits „The
Turning” war ein kleines Highlight, im März folgte mit
„Massive Stars“ ein weiteres, bevor „Waiting for a
Return“ die Vorfreude schon extrem steigerte: Neben
„Chasing the Sun“ eins der Highlights des Albums, das
mittlerweile veröffentlicht ist, zumindest aus Sicht des Dream The
Electric Sleep-Fans. Denn wie es sich für ein Soloalbum
gehört, schlägt das Album nicht in dieselbe Kerbe seiner
Band. Ganz so extrem wie Page es selbst beschreibt, nämlich als
eine Mischung aus Alternative Rock meets Progressive Pop meets Folk
Americana würde ich es, v.a. was den letzten Teil betrifft, nicht
bezeichnen, aber es ist schon weniger Wall of Sound. Don Henley,
Kansas, Asia und Peter Gabriel oder aber die Spät-Achziger Simple
Minds wären mögliche Orientierungshilfen, ohne jetzt direkte
Vergleichsmöglichkeiten unterstellen zu wollen. Die Musik und
Texte von „Apocalypse Garden“ wurden komplett von Page
allein geschrieben, zudem spielte der Sänger aus Kentucky Gitarre,
Bass, Keyboards und Drums alleine ein. Produzent, der er ist,
übernahm er auch gleich die Produktion, lediglich für den Mix
nahm er die Hilfe von Nathan Yarborough in Anspruch. Ein Album, das in
einer gerechten Welt durchaus einige Wellen schlagen würde!
Für KW 21: Amarok – Hope (Oskar)
 Zum
25jährige Jubiläum gibt es das siebte Album des Polen Michał
Wojtas und seinem Projekt Amorok. Anfangs, wie der Name schon andeutet,
v.a. von Mike Oldfield inspiriert, ist Pink Floyd ein weiterer,
wichtiger Eckpfeiler seines Sounds geworden. Und für das neue
Album würde ich noch die Dire Straits mit ins Feld führen
wollen, denn es gibt mehrere Momente, die an Mark Knopfler(s Songs)
erinnern („Insomnia“; ), sowie in den ruhigen Songs die
Norweger Gazpacho. Gitarrenbasierter und stark
keyboardunterstützter Rock zwischen Melodie, Prog, Folk und
Ambient würde ich das hier zusammenfassen wollen – wobei die
letzten beiden Zutaten nicht überbewertet werden sollten. Sie
bringen nur weitere Klangfarben mit ein in einen Sound, der immer
wieder atmosphärisch sehr stark ist, tolle Gitarrensoli beinhaltet
und ansonsten abwechslungsreich zwischen Rocksong, Groove bis hin zu
ganz ruhigen Momenten einiges zu bieten hat. Dabei beginnt es etwas
holprig: Der ansonsten gute Gesang von Michał Wojtas ist zunächst
etwas ungewöhnlich akzentuiert („stay huMÄN“), im
Opener versucht sich seine Frau Marta im (leider nicht akzentfreien)
Sprechgesang und zum Abschluss gibt es einen Song in polnisch,
ansonsten gibt es aber nichts zu meckern. „Trail“
überrascht mit einem Trance-Rhythmus, kann aber auch in dem
Rock-Umfeld durchaus überzeugen – und dank seiner variablen
Gitarrenparts auch definitiv mehr als Galahads Versuche in dieser
Richtung. Ein Album, das mich v.a. mit seinen verschiedenen
Atmosphären gepackt hat!
Zum
25jährige Jubiläum gibt es das siebte Album des Polen Michał
Wojtas und seinem Projekt Amorok. Anfangs, wie der Name schon andeutet,
v.a. von Mike Oldfield inspiriert, ist Pink Floyd ein weiterer,
wichtiger Eckpfeiler seines Sounds geworden. Und für das neue
Album würde ich noch die Dire Straits mit ins Feld führen
wollen, denn es gibt mehrere Momente, die an Mark Knopfler(s Songs)
erinnern („Insomnia“; ), sowie in den ruhigen Songs die
Norweger Gazpacho. Gitarrenbasierter und stark
keyboardunterstützter Rock zwischen Melodie, Prog, Folk und
Ambient würde ich das hier zusammenfassen wollen – wobei die
letzten beiden Zutaten nicht überbewertet werden sollten. Sie
bringen nur weitere Klangfarben mit ein in einen Sound, der immer
wieder atmosphärisch sehr stark ist, tolle Gitarrensoli beinhaltet
und ansonsten abwechslungsreich zwischen Rocksong, Groove bis hin zu
ganz ruhigen Momenten einiges zu bieten hat. Dabei beginnt es etwas
holprig: Der ansonsten gute Gesang von Michał Wojtas ist zunächst
etwas ungewöhnlich akzentuiert („stay huMÄN“), im
Opener versucht sich seine Frau Marta im (leider nicht akzentfreien)
Sprechgesang und zum Abschluss gibt es einen Song in polnisch,
ansonsten gibt es aber nichts zu meckern. „Trail“
überrascht mit einem Trance-Rhythmus, kann aber auch in dem
Rock-Umfeld durchaus überzeugen – und dank seiner variablen
Gitarrenparts auch definitiv mehr als Galahads Versuche in dieser
Richtung. Ein Album, das mich v.a. mit seinen verschiedenen
Atmosphären gepackt hat!
Für KW 20: Hot Water Music - Vows (End Hits Records / Cargo|The Orchard)
Du würdest dich über ein neues Album von Stilkin freuen? Oder trauerst den frühen Tagen von Gaslight Anthem hinterher? "Those Days are over now, this is your new place to call home", um mal Hot Water Music (frei) zu zitieren (Bury Us All). Die alten Fans wissen natürlich längst, was sie hier erwarten können, neue Fans werden gerne hinzu genommen: Hot Water Music ist die energetische Indie-Rockmischung mit leidenschaftlichen, melancholischen Gesang, die dir die Ohren freiblasen. Früher hieß das mal Punk, dann hieß es Grunge, heute schlicht Alternative Rock - also der neue Mainstream :-) The times they are a-changing. "Vows" ist - pünktlich zum 30. Jubiläum - das zehnte Album der Truppe um Sänger Chuck Ragan, und ich würde sagen, wieder einmal alles richitg gemacht. Im November kommen sie damit auch noch Deutschland auf Tour!
Für KW 19: Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (Capitol / Universal Music)
 Die
Kings of Leon blasen zum Großangriff. 2024 soll ihr Jahr werden:
Mit groß angelegter US-Tournee und
Übersee-Festivalauftritten (unter anderem als Headliner beim
Deichbrand Festival) und vor allem mit diesen neuen Album. Und sie
haben auch schon die Big Player identifiziert, die ihnen dabei helfen
sollen: Im Indie Rock Sektor haben sie lange genug an ihrer Credibility
gearbeitet, haben langsam ihren Weg in den musikalischen Mainstream
gebahnt. Neben Capitol als neuem Plattenlabel und Live Nation als Tour
Partner, jetzt folgt der breitenwirksame Angriff aufs Radio. Und nicht
nur der Opener "Ballerina Radio" ist dazu geschaffen, sich hier an den
Mann oder an die Frau zu bringen. Das Album strotzt nur so vor
radiokompatiblen Songs, mit harmlosen Allerweltstexten ausgestattet
aber immerhin gewürzt mit ziemlich cooler Rock Instrumentierung
und natürlich der genialen Stimme von Caleb Followill. Die beiden
Rock Tracks haben sie legitimer Weise auf die zweite Hälfte des
Albums gepackt. "Nothing to Do", der mit seinem R.E.M. Charme an die
ruppigeren Indierocktage erinnert und "Hesitation Generation", das
zudem das typische, unnachahmliche coole Flair dieser Band besitzt,
sehr passend ergänzt noch durch das dazwischen platzierte
„Television“, werden die Songs sein – auf die sich
die alten Fans stürzen werden. Ob die sie davon abhalten werden,
einen Ausverkauf zu beklagen, bleibt abzuwarten. Falls es also wirklich
noch jemanden gibt, der diese großartige Band noch nicht für
sich entdeckt hat, man wird 2024 nicht an ihnen vorbeikommen. Die Kings
of Leon haben – dem Albumtitel folgend mit viel Spaß
– vorgelegt, nun werden wir sehen, ob die Welt bereit ist
für sie.
Die
Kings of Leon blasen zum Großangriff. 2024 soll ihr Jahr werden:
Mit groß angelegter US-Tournee und
Übersee-Festivalauftritten (unter anderem als Headliner beim
Deichbrand Festival) und vor allem mit diesen neuen Album. Und sie
haben auch schon die Big Player identifiziert, die ihnen dabei helfen
sollen: Im Indie Rock Sektor haben sie lange genug an ihrer Credibility
gearbeitet, haben langsam ihren Weg in den musikalischen Mainstream
gebahnt. Neben Capitol als neuem Plattenlabel und Live Nation als Tour
Partner, jetzt folgt der breitenwirksame Angriff aufs Radio. Und nicht
nur der Opener "Ballerina Radio" ist dazu geschaffen, sich hier an den
Mann oder an die Frau zu bringen. Das Album strotzt nur so vor
radiokompatiblen Songs, mit harmlosen Allerweltstexten ausgestattet
aber immerhin gewürzt mit ziemlich cooler Rock Instrumentierung
und natürlich der genialen Stimme von Caleb Followill. Die beiden
Rock Tracks haben sie legitimer Weise auf die zweite Hälfte des
Albums gepackt. "Nothing to Do", der mit seinem R.E.M. Charme an die
ruppigeren Indierocktage erinnert und "Hesitation Generation", das
zudem das typische, unnachahmliche coole Flair dieser Band besitzt,
sehr passend ergänzt noch durch das dazwischen platzierte
„Television“, werden die Songs sein – auf die sich
die alten Fans stürzen werden. Ob die sie davon abhalten werden,
einen Ausverkauf zu beklagen, bleibt abzuwarten. Falls es also wirklich
noch jemanden gibt, der diese großartige Band noch nicht für
sich entdeckt hat, man wird 2024 nicht an ihnen vorbeikommen. Die Kings
of Leon haben – dem Albumtitel folgend mit viel Spaß
– vorgelegt, nun werden wir sehen, ob die Welt bereit ist
für sie.
Für KW 18: Carpet - Collision (Kapitän Platte / Cargo Records)
Das Sextett aus Augsburg ist zurück mit dem zweiten Streich.
Nachdem der erste schon extrem gut angekommen war, dürfte  sich
der Interessentenkreis mit „Collision“ noch weiter
vergrößern. Wobei die Zielgruppe nicht klar definiert werden
kann – was für manche Band manchmal ein Problem scheint,
weil sie nirgends zugehörig scheinen. Carpet überzeugen aber
durch ihre Energie und Spielfreude sowie ihre problemlose Art, die
Stile zu vermischen und die guten Songs, die dabei im Vordergrund
stehen.
sich
der Interessentenkreis mit „Collision“ noch weiter
vergrößern. Wobei die Zielgruppe nicht klar definiert werden
kann – was für manche Band manchmal ein Problem scheint,
weil sie nirgends zugehörig scheinen. Carpet überzeugen aber
durch ihre Energie und Spielfreude sowie ihre problemlose Art, die
Stile zu vermischen und die guten Songs, die dabei im Vordergrund
stehen.
Das beginnt im Opener „The Moonlight Rush“ damit, dass der
vermeintliche Blues/Retro Rock Rhythmus ungewöhnlich schräg,
bzw. vertrackt ist. Setzt sich fort im fetten Sound einer Postrock
Offensive und wird nach 4 Minuten komplett aufgebrochen durch Break und
zurückhaltende Bläsersounds, bevor der Song für die
finalen anderthalb Minuten zurückkehrt zum Rock. Und ist es genau
dieses Wechselspiel aus klassischen Zutaten und unvorhersehbaren
Momenten, dass dieses Album so spannend macht und über den
Durchschnitt hebt. Rock, Blues, Psychedelic, Retro- und Postrock werden
mit Versatzstücken aus Prog erweitert und zu einem Gesamtmix
vereint, der keinen Rockfan außen vor lässt. Beeindruckend,
zeitlos, begeisternd.
Für KW 17: Transatlantic - Live at Morsefest 2022: The Absolute Whirlwind
(InsideOutMusic/Sony Music)
 Mehren
sich die Anzeichen für ein Ende der Band? Obwohl noch nicht
offiziell für tot erklärt, beginnen die Hinterbliebenen mit
einer Testamentseröffnung. Hier: Morsefest 22. Was für ein
Fest! Dabei war schon die letzte Veröffentlichung The Final
Flight Live At L'Olympia vor gut einem Jahr ein Live-Album,
nämlich die unglaubliche Dokumentation ihrer Tournee zum
fünften Album „The Absolute Universe“. Das Konzert
beim Morsefest im April 22 war auch Teil dieser Tournee, nur spielten
sie hier zwei Abende hintereinander und mit zwei unterschiedlichen
Sets. In der ersten Nacht spielte die Band "The Whirlwind" in seiner
Gesamtheit, zum ersten Mal seit 10 Jahren. Dazu gab es Songs aus dem
vierten Album "Kaleidoscope" sowie u.a. den Procol Harum-Klassiker "In
Held 'Twas In I" vom Debütalbum "SMPTe", den sie bislang noch nie
live gespielt hatten.
Mehren
sich die Anzeichen für ein Ende der Band? Obwohl noch nicht
offiziell für tot erklärt, beginnen die Hinterbliebenen mit
einer Testamentseröffnung. Hier: Morsefest 22. Was für ein
Fest! Dabei war schon die letzte Veröffentlichung The Final
Flight Live At L'Olympia vor gut einem Jahr ein Live-Album,
nämlich die unglaubliche Dokumentation ihrer Tournee zum
fünften Album „The Absolute Universe“. Das Konzert
beim Morsefest im April 22 war auch Teil dieser Tournee, nur spielten
sie hier zwei Abende hintereinander und mit zwei unterschiedlichen
Sets. In der ersten Nacht spielte die Band "The Whirlwind" in seiner
Gesamtheit, zum ersten Mal seit 10 Jahren. Dazu gab es Songs aus dem
vierten Album "Kaleidoscope" sowie u.a. den Procol Harum-Klassiker "In
Held 'Twas In I" vom Debütalbum "SMPTe", den sie bislang noch nie
live gespielt hatten.
In der zweiten Nacht wurde „The Absolute Universe - The Ultimate
Edition“ in voller Länge aufgeführt, die alle Titel der
beiden Versionen des Albums vereint. Abgerundet wurde das noch mit
einem Medley der Longtracks der ersten beiden Alben der Band. Das Ganze
wurde erweitert von einem Chor und einer Streichergruppe, viel
großartiger kann man ein so besonderes Wochenende gar nicht
begehen. Jetzt festgehalten auf 5 CDs + 2 Blu-ray und den üblichen
Spielereien drumherum, ein absolutes Juwel. Es ist nur schwer
vorstellbar, dass das alles gewesen sein soll….
Für KW 16: Pearl Jam - Dark Matter (Monkeywrench-Republic / Universal)

Auf englisch würde ich sagen ´the opener sets the pace´,
denn er steht exemplarisch für den Härtegrad des Albums. Da gab es sicherlich
schon härtere Alben, im Bereich dessen, was man mal als Grunge bezeichnete,
bewegt sich dieses Album noch immer, aber es gibt keine extremen Ausreißer.
Höchstens im Hinblick auf zugängliche/Pop-Momente. "Wreckage" ist
fast eine Ballade mit Tom Petty-Momenten, "Won’t Tell" hat, v.a. in
der Gitarrenarbeit den U2-Moment, auch das erste Highlight "Upper
Hand" startet soft, bevor es sich erst im letzten Teil zur Rockhymne
steigert - und "Got to Give" hat den (sich wiederholenden) David
Bowie-Moment ("Let`s Dance"!), aber das sind alles Vergleiche, die
Pearl Jam jetzt nicht in unnötig flache Gewässer manövrieren. Den gegenüber
stehen ein paar kräftige Rock Songs und ein paar echte Hymnen. "Dark
Matter" und klasse abwechslungsreich, macht extrem viel Spaß und geht viel
zu schnell vorbei. Vor allem wenn sie wie in "Waiting for Stevie"
auch noch einen echten "Alive"-Nachfolger auspacken, der spätestens
live zum echten Monstersong hochgeschraubt werden könnte. Live sind sie
übrigens am 2. & 3. Juli in der Waldbühne, Berlin...
Für KW 15: Kettcar - Gute Laune ungerecht verteilt (Grand Hotel van Cleef / The Orchard / Indigo)
Für alle die n och nicht eingeschlafen sind: Vielleicht ihr
politischstes Album! Gar nicht mal unbedingt ihr bestes, ich glaube,
das bleibt
für mich "Ich vs. wir", aber einmal mehr mit Texten, die man
gehört haben sollte. Mit Aussagen auf den Punkt gebracht, ohne
übertriebene Wiederholungen im Sportfreunde Stiller-Stil aber mit
genügend Nachdruck, um Eindruck zu hinterlassen. Also machen sie
zu ihrer Waffe, was sie in die Hand nehmen (frei nach: "Blaue Lagune"):
Stift (Bassist Reimer Bustorff und Hauptsongschreiber Marcus Wiebusch)
und Mikro. Verpackt in Songs, die einmal mehr die komplette Bandbreite
von Rockgewitter bis Akustiksong besitzt, inklusive aller
Qualitäten, die man von ihnen kennt.
och nicht eingeschlafen sind: Vielleicht ihr
politischstes Album! Gar nicht mal unbedingt ihr bestes, ich glaube,
das bleibt
für mich "Ich vs. wir", aber einmal mehr mit Texten, die man
gehört haben sollte. Mit Aussagen auf den Punkt gebracht, ohne
übertriebene Wiederholungen im Sportfreunde Stiller-Stil aber mit
genügend Nachdruck, um Eindruck zu hinterlassen. Also machen sie
zu ihrer Waffe, was sie in die Hand nehmen (frei nach: "Blaue Lagune"):
Stift (Bassist Reimer Bustorff und Hauptsongschreiber Marcus Wiebusch)
und Mikro. Verpackt in Songs, die einmal mehr die komplette Bandbreite
von Rockgewitter bis Akustiksong besitzt, inklusive aller
Qualitäten, die man von ihnen kennt.
Sieben Jahre seit ihrem letzten Album, was sogar bei ihrem Rhythmus
extrem lange ist. Aber immerhin gab es eine EP und ein Live-Album
zwischendurch, dann noch Corona, da will man auch gar nicht
unnötig drängeln. Aus dem Alter chartshungriger
Boygroup-Kollegen sind sie eh raus, da dürfen die Kreativität
und Songs auch gerne in Ruhe reifen. Aber jetzt geht es wieder
los: Die Tournee läuft bereits, Nachschlag im Sommer ist
bereits gebucht. Also lasst sie euch nicht entgehen. Denkt dran:
„Nicht alle in Hamburg wollen zu König der Löwen“
(„Einkaufen in Zeiten des Krieges“)
Für KW 14: MONKEY3 - Welcome To The Machine (Napalm Records)
Mensch vs. Maschine: Welcome To The Machine ist inspiriert von Filmen wie 2001: A Space Oddissey, Matrix, Sunshine, Solaris oder 1984. Dabei scheint der Weltraum die ideale Spielwiese, um ihrer Mischung aus Rockgitarren-Soundgewittern und elektronischen Sounds und Spielereien freien Lauf zu lassen. Und wenn man sich drauf einlässt, schaffen die Schweizer es auch ohne Gesang, Geschichten zu erzählen. Vorsichtig herantastend, mit voller Gewalt laut polternd, experimentell erforschend, hin und her gerissen zwischen melodischen Phasen und progressiven Breaks bietet "Welcome To The Machine" maximale Abwechslung. Und passend zum Albumtitel erinnern sie dabei nicht selten an Pink Floyd, v.a. im abschließenden 13minütigen "Collapse". Großes Kino!
Für KW 13: sleepmakeswaves - It’s Here, But I Have No Names For It (Bird's Robe Records / MGM)
 Nicht
lange fackeln: Eine halbe Minute lang beginnt die CD mit unheilvollem
Brodeln und dann gehen sie gleich in die Vollen. Die Australier
entscheiden sich für den größten Teil ihres neuen
Albums, ihren PostRock in der energetischeren Variante aufzufahren.
Acht Songs zwischen drei- und achteinhalb Minuten, die einem mit
mitreißenden Gitarrensoli um die Ohren fliegen, nur vereinzelt
durch atmosphärische Breaks unterbrochen. Dabei hauen sie immer
wieder spannende Hooklines raus, die es in der Tat schaffen, sich auch
ohne Gesang und Refrain im Ohr festzusetzen. Zwischendurch gibt
es auch zwei ruhigere Songs, so dass auch das Album als Ganzes ein
abgerundetes Wechselbad darstellt, bei dem keine Langeweile aufkommt.
Und dann dieser Albumtitel… klasse!
Nicht
lange fackeln: Eine halbe Minute lang beginnt die CD mit unheilvollem
Brodeln und dann gehen sie gleich in die Vollen. Die Australier
entscheiden sich für den größten Teil ihres neuen
Albums, ihren PostRock in der energetischeren Variante aufzufahren.
Acht Songs zwischen drei- und achteinhalb Minuten, die einem mit
mitreißenden Gitarrensoli um die Ohren fliegen, nur vereinzelt
durch atmosphärische Breaks unterbrochen. Dabei hauen sie immer
wieder spannende Hooklines raus, die es in der Tat schaffen, sich auch
ohne Gesang und Refrain im Ohr festzusetzen. Zwischendurch gibt
es auch zwei ruhigere Songs, so dass auch das Album als Ganzes ein
abgerundetes Wechselbad darstellt, bei dem keine Langeweile aufkommt.
Und dann dieser Albumtitel… klasse!
Für KW 12: RPWL - True Live Crime (Gentle Art Of Music/Soulfood)
Elf Studioalben haben uns die Freisinger in den letzten 24 Jahren
kredenzt, das letzte gab es 2023, einmal mehr ein Konzeptalbum und  einmal
mehr sehr erfolgreich: In den deutschen Albumcharts startete es durch
bis auf Platz 18. Es folgte eine lange Europa-Tour durch 8 Länder,
das vorliegende Live-Dokument (2CD / Blu-Ray) ist der Nachschlag. Ein
komplettes Konzert der Tour. Wie bei Konzeptalben nicht
ungewöhnlich, gibt es zunächst die komplette Aufführung
des Albums “Crime Scene” in seiner Gänze und am
Stück. Die zweite Hälfte besteht dann aus einem Querschnitt
durch ihre Diskografie – was bei 6 Songs aus 10 Studioalben
zwangsläufig etwas beschränkt bleibt. Aber sie bilden einen
starken Kontrast. Nach der v.a. inhaltlich, selten wirklich musikalisch
schweren Kost gibt es u.a. mit “Hole in the Sky”,
“Unchain The Earth” und dem im Original mit
Unterstützung von Ray Wilson eingesungenen „Roses“
drei ihrer „Hits“, also die Art von Kompositionen, die von
ihren Vorbildern Pink Floyd locker zum Hit hätten werden
können. Die Freisinger haben diese Marktwirkung nicht ganz, Hits
sind es irgendwie trotzdem. Auf "Crime Scene"gab es so einen zwar
nicht, dafür hatte es andere Qualitäten, die sich teilweise
auch erst nach mehrmaligen Hören entfaltet haben. In seiner
Kombination ist das hier einmal mehr ein beeindruckendes Beispiel ihrer
Fähigkeiten.
einmal
mehr sehr erfolgreich: In den deutschen Albumcharts startete es durch
bis auf Platz 18. Es folgte eine lange Europa-Tour durch 8 Länder,
das vorliegende Live-Dokument (2CD / Blu-Ray) ist der Nachschlag. Ein
komplettes Konzert der Tour. Wie bei Konzeptalben nicht
ungewöhnlich, gibt es zunächst die komplette Aufführung
des Albums “Crime Scene” in seiner Gänze und am
Stück. Die zweite Hälfte besteht dann aus einem Querschnitt
durch ihre Diskografie – was bei 6 Songs aus 10 Studioalben
zwangsläufig etwas beschränkt bleibt. Aber sie bilden einen
starken Kontrast. Nach der v.a. inhaltlich, selten wirklich musikalisch
schweren Kost gibt es u.a. mit “Hole in the Sky”,
“Unchain The Earth” und dem im Original mit
Unterstützung von Ray Wilson eingesungenen „Roses“
drei ihrer „Hits“, also die Art von Kompositionen, die von
ihren Vorbildern Pink Floyd locker zum Hit hätten werden
können. Die Freisinger haben diese Marktwirkung nicht ganz, Hits
sind es irgendwie trotzdem. Auf "Crime Scene"gab es so einen zwar
nicht, dafür hatte es andere Qualitäten, die sich teilweise
auch erst nach mehrmaligen Hören entfaltet haben. In seiner
Kombination ist das hier einmal mehr ein beeindruckendes Beispiel ihrer
Fähigkeiten.
Für KW 11: Royal Tusk - Altruistic (MNRK Music)
 Ich
habe früher schon immer bei Three Doors Down (was machen die
eigentlich heute?) gesagt, dass sie im Prinzip die ihn moderne Version
des Hardrock der 80er sind. Darauf im Interview angesprochen, fanden
sie die Idee selber allerdings nicht so witzig. Royal Tusk sind jetzt
der Missing Link für Three Doors Down und Europe, die ja
auch zuletzt schon immer wieder mehr oder weniger erfolgreich versucht
haben ihren Hardrock moderner zu gestalten. Royal Tusk machen das
deutlich erfolgreicher mit wirklich gelungenem, meist eher
kräftigem Rock zwischen Hardrock & Alternative Rock! In
manchen Songs erinnern sie auch an die Blackout Problem, bzw.
Badfinger. Sehr cool. Tolles Album, abwechslungsreich, gute Songs, kein
Ausfall.
Ich
habe früher schon immer bei Three Doors Down (was machen die
eigentlich heute?) gesagt, dass sie im Prinzip die ihn moderne Version
des Hardrock der 80er sind. Darauf im Interview angesprochen, fanden
sie die Idee selber allerdings nicht so witzig. Royal Tusk sind jetzt
der Missing Link für Three Doors Down und Europe, die ja
auch zuletzt schon immer wieder mehr oder weniger erfolgreich versucht
haben ihren Hardrock moderner zu gestalten. Royal Tusk machen das
deutlich erfolgreicher mit wirklich gelungenem, meist eher
kräftigem Rock zwischen Hardrock & Alternative Rock! In
manchen Songs erinnern sie auch an die Blackout Problem, bzw.
Badfinger. Sehr cool. Tolles Album, abwechslungsreich, gute Songs, kein
Ausfall.
Für KW 10: Big Big Train - The Likes of Us (InsideOutMusic / Sony Music )
Jetzt also Album #1 nach dem wunderbaren Sänger David Longdon,
der die Band 12 Jahre lang in eine neue Liga angeführt hatte, und
der Ende 2021 nach einem Unfall verstarb. Schon das 2022er „Welcome to the
Planet“ war posthum veröffentlicht, 2023 gab es sogar noch
die atemberaubende Zugabe, „Ingenious Devices“ mit neu
aufgenommenen und mit Orchester erweiterten Aufnahmen, auf dem sie noch
einmal alle Register gezogen und die Messlatte ein weiteres Mal
höher gelegt haben. Das macht es für „The Likes of
Us“ nicht leichter, aber vielleicht brauchten sie ja den Druck.
Das Album besteht aus 8 Songs, die diese Herausforderung annehmen und
dabei eine beeindruckende Figur machen. Mit einem Sänger, der zwar
anders ist, der es aber schafft, mit seinem ähnlich warmen Timbre
eine sehr vergleichbare Stimmung zu erzeugen. Zudem bringt sich auch
Drummer Nick D’Virgilio mit Duett- und Backing Vocals immer
wieder hörbar genial ein, was in “Miramare” locker
Moon Safari-Qualitäten erreicht. Mit 8 komplett neuen Songs, die
wie ein Querschnitt durch die gesamte Prog Historie sind und dabei
letztlich ein Streifzug durch ihre eigene gut 30jährige Geschichte
darstellen. Mit Sounds, die mal an die Genesis, mal Marillion und mal
an Steven Wilson erinnern während sie es auch dieses Mal schaffen,
diese Einflüsse auf komplett eigene Weise zu verarbeiten und in
Songs zu gießen. Und wie alle Genannten, schaffen auch Big Big
Train immer wieder den Wechsel aus progressiv-verspielten Passagen und
grandios melodischen Auflösungen, garniert mit tollen Soli und
Harmonien. Ein Album, dass man problemlos in Dauerrotation hören
kann, bei dem man sich dann nur die Texte irgendwann hier und da ein
wenig gehaltvoller wünscht.
2021 nach einem Unfall verstarb. Schon das 2022er „Welcome to the
Planet“ war posthum veröffentlicht, 2023 gab es sogar noch
die atemberaubende Zugabe, „Ingenious Devices“ mit neu
aufgenommenen und mit Orchester erweiterten Aufnahmen, auf dem sie noch
einmal alle Register gezogen und die Messlatte ein weiteres Mal
höher gelegt haben. Das macht es für „The Likes of
Us“ nicht leichter, aber vielleicht brauchten sie ja den Druck.
Das Album besteht aus 8 Songs, die diese Herausforderung annehmen und
dabei eine beeindruckende Figur machen. Mit einem Sänger, der zwar
anders ist, der es aber schafft, mit seinem ähnlich warmen Timbre
eine sehr vergleichbare Stimmung zu erzeugen. Zudem bringt sich auch
Drummer Nick D’Virgilio mit Duett- und Backing Vocals immer
wieder hörbar genial ein, was in “Miramare” locker
Moon Safari-Qualitäten erreicht. Mit 8 komplett neuen Songs, die
wie ein Querschnitt durch die gesamte Prog Historie sind und dabei
letztlich ein Streifzug durch ihre eigene gut 30jährige Geschichte
darstellen. Mit Sounds, die mal an die Genesis, mal Marillion und mal
an Steven Wilson erinnern während sie es auch dieses Mal schaffen,
diese Einflüsse auf komplett eigene Weise zu verarbeiten und in
Songs zu gießen. Und wie alle Genannten, schaffen auch Big Big
Train immer wieder den Wechsel aus progressiv-verspielten Passagen und
grandios melodischen Auflösungen, garniert mit tollen Soli und
Harmonien. Ein Album, dass man problemlos in Dauerrotation hören
kann, bei dem man sich dann nur die Texte irgendwann hier und da ein
wenig gehaltvoller wünscht.
Für KW 9: The Waterboys - 1985 (Chrysalis, Proper / Bertus)
 Der
besondere Wert ihres 85er Albums "This Is The Sea" ist, glaube
ich, unumstritten. Und genau deswegen erhält es auch eine
verdiente Würdigung in Form einer solchen Box. Selbst wenn ich die
Waterboys die Jahrzehnte danach immer im Auge hatte und mehr oder
weniger verfolgt habe, hat kein Album die Reife und Qualität
dieses 85er Meisterwerks erreichen können. Und hatte ich mich
anfangs noch über die Aufteilung gewundert, dass nämlich das
Album selber erst CD Nummer sechs in dieser Box darstellt, wird die
Reihenfolge beim und spätestens nach dem Hören klar und
logisch. Denn es geht hier nicht um eine Neuauflage in remasterter
Qualität mit Bonustracks und sonstigen Extras, sondern um das
Drumherum und v.a. den Weg dahin.
Der
besondere Wert ihres 85er Albums "This Is The Sea" ist, glaube
ich, unumstritten. Und genau deswegen erhält es auch eine
verdiente Würdigung in Form einer solchen Box. Selbst wenn ich die
Waterboys die Jahrzehnte danach immer im Auge hatte und mehr oder
weniger verfolgt habe, hat kein Album die Reife und Qualität
dieses 85er Meisterwerks erreichen können. Und hatte ich mich
anfangs noch über die Aufteilung gewundert, dass nämlich das
Album selber erst CD Nummer sechs in dieser Box darstellt, wird die
Reihenfolge beim und spätestens nach dem Hören klar und
logisch. Denn es geht hier nicht um eine Neuauflage in remasterter
Qualität mit Bonustracks und sonstigen Extras, sondern um das
Drumherum und v.a. den Weg dahin.
Vor ein paar Jahren hätte ich mich richtig über so eine Box
gefreut, denn das ist ja eigentlich genau das, was das Sammlerherz so
möchte. Demos, Entwicklungsstadien, unveröffentlichte Songs,
was will man mehr? Insgesamt 95 Tracks, davon 64 bisher
unveröffentlicht, dazu ein 220-seitiges Booklet! Aber die Betonung
liegt auf vor ein paar Jahren, denn abgesehen davon dass ich jetzt
nicht mehr unbedingt auf der Suche bin nach einem derart umfassenden
Überblick über die Entstehungsgeschichte dieses tollen
Albums, habe ich vor ein paar Jahren auf YouTube so grandiose
Live-Videos dieser Band gefunden, dass ich ein paar davon in solch
einer besonderen Box viel spannender gefunden hätte.
So kann man die Detailtreue an dieser Stelle gut finden, oder nicht,
mir hätten ein paar Live Versionen Der Songs – sozusagen als
Die Entwicklungen danach, noch mehr gebracht. So oder so: Am Ende wird
klar, dass das Album in seiner veröffentlichten Version die
bestmögliche Version der Waterboys und der Songs für dieses
Album darstellt. 2, 3 Songs dieser Sammlung hätten bestimmt noch
mit zum hohen Qualitätsstandard gepasst, allen voran das wirklich
tolle und zu Unrecht versteckte „The Ways Of Men“ und eine
Extended Version des ein oder anderen Songs ist sicherlich spannend
für Fans, aber Alben waren in den Achtzigern eben nur 45 Minuten
lang die sind so optimal gefüllt, genau das macht CD 6 dieser Box
deutlich.
Für KW 8: Revolution Saints - Against the Winds (Frontiers Records)
Ein fast offizielles Journey Album. Nachdem Drummer Dean Castronovo nicht nur Journey Songwriter und Teilzeitsänger ist, sondern auch bei Neal Schon solo den Journey-Anteil singt, und zudem Journey jetzt nicht die fleißigsten Albumveröffentlicher sind, ganz im Gegensatz zu Dean Castronovo, wird es wohl niemanden stören, dies als Journey II durchgehen zu lassen. Zumal Gesang und die instrumentalen Beiträge von Jeff Pilson und v.a. Gitarrist Joel Hoekstra Extraklasse sind. Die Songs sind dieses Mal nicht durchweg spektakulär, aber das sind sie bei Journey auch nicht immer. Die Zutaten sind dieselben, einzelne Highlights sind dazwischen: Glückwunsch wenn du (jetzt) zu den Insidern unter den interessierten gehörst. Auch dieses Album lohnt ein Antesten!
Für KW 7: Steve Hackett - The Circus and the Nightwhale (InsideOut / Sony)
 Ich
beteilige mich eigentlich ungern an „What
if“-Spekulationen, aber im Falle von Steve Hackett hatte ich mich
unlängst gefragt, warum er eigentlich nicht einfach mal seine
alten Schulbandkollegen einlädt, um zu sehen, was da rauskommt.
Das Wundervolle an den immer wieder vorkommenden Reunions ist ja, dass
sie es immer wieder schaffen, an den alten Sound anzuknüpfen. Und
je länger die Pause, desto größer die
Übereinstimmungen, was z.T. daran liegen könnte, dass sie
einfach kein Problem damit haben, an den alten Sound wieder
anzuknüpfen, sondern es stattdessen eher selbst als
Herausforderung sehen, genau das zu schaffen. Wie könnte das bei
Steve Hackett aussehen?
Ich
beteilige mich eigentlich ungern an „What
if“-Spekulationen, aber im Falle von Steve Hackett hatte ich mich
unlängst gefragt, warum er eigentlich nicht einfach mal seine
alten Schulbandkollegen einlädt, um zu sehen, was da rauskommt.
Das Wundervolle an den immer wieder vorkommenden Reunions ist ja, dass
sie es immer wieder schaffen, an den alten Sound anzuknüpfen. Und
je länger die Pause, desto größer die
Übereinstimmungen, was z.T. daran liegen könnte, dass sie
einfach kein Problem damit haben, an den alten Sound wieder
anzuknüpfen, sondern es stattdessen eher selbst als
Herausforderung sehen, genau das zu schaffen. Wie könnte das bei
Steve Hackett aussehen?
Wenn man dann allerdings das neue Album hört fragt man sich
unweigerlich: Hat er das überhaupt nötig? Ganz im Ernst: je
älter der Genesis-Veteran wird, desto besser werden seine
Soloalben. Je mehr er sich mit seiner Vergangenheit versöhnt,
desto näher kommt er den alten Trademarks. Das liegt zum einen am
richtig guten Songwriting, zum anderen an der immensen Abwechslung (ein
Blick auf den Waschzettel verrät: Die liegt u.a. an den
zahlreichen Gastbeiträgen von u.a. Roger King, Jonas Reingold, Nad
Sylvan, Craig Blundell, Amanda Lehmann oder Nick D’Virgilio) und
nicht zuletzt an der Furchtlosigkeit, sich an genau diesen alten
Trademarks zu bedienen. Komplexe Song-Arrangements, Songs, die
ineinander übergehen und zu Longtracks verschmelzen. Und wenn er
dann noch, wie im Beginn von „Wherever You Are“ ein
Genesis-Zitat verwendet, dann hebt das seine eigenen Songs noch mehr in
den Fokus. Ansonsten reicht die Bandbreite dieses Mal von klassischen
Streich(el)einheiten (wunderbar!) bis zu türkisch anmutenden
orientalischen Sounds (gewöhnungsbedürftig). Ganz am Anfang
fragt die Stimme aus dem Off „Are you sitting comfortably“,
bevor ein Zug gemütlich loszuckelt. Spätestens nach dem 3.
Song ist klar, dass dies keineswegs eine ruhige Entspannungsreise wird,
sondern eher eine Achterbahnfahrt, soviel passiert hier. Allerdings
muss man dazusagen, dass das Album wohl als Ganzes absolut
überzeugt, ein wirkliches Song-Highlight gibt es nicht. Was dann
doch die Frage aufwirft, inwieweit sich das durch die (oder alternativ
auch nur einen? der) o.g. Band-Kollegen ändern würde. Aber
ich fürchte, das bleibt eine What-if-Spekulation. Für seinen
Auftritt bei der (finalen!) Loreley Night of the Prog Auftritt ist er
hiermit jedenfalls bestens gerüstet.
Für KW 6: Daniel WIRTZ - DNA (Label: Wirtzmusik)
Der erste Gedanke zur Wandlungsfähigkeit eines Musikers, den
ich gerade zum neuen Neal Morse-Album gesponnen habe (s.u.),  lässt
sich an dieser Stelle nahtlos weiterdenken. Denn auch Daniel Wirtz ist
ein Musiker, der sich seit seiner Wandlung vom (Englisch singenden)
Sub7even-Frontmann zum Solokünstler (mit deutschen Texten) zwar
immer wieder neue Themen sucht, variiert gerne seine Lautstärke und
Geschwindigkeit, hat mit seinen Unplugged Alben und Tourneen bewiesen,
dass seine Songs auch ohne Strom wunderbar funktionieren, aber bleibt
sich doch letztlich immer treu. Das gilt auch für sein neues
Album, das erste Studioalbum seit 7 (!) Jahren. Womit die Pause
länger war, als je zuvor, o.g. Tourneen und natürlich die
Pandemie haben ihren Teil dazu beigetragen. Vielleicht war es ihm
deswegen schon fast ein Anliegen, zu beweisen, dass er trotzdem noch
der Alte ist. Also rockt er zu fetten Gitarrenriffs und treibenden
Drums in den beiden Openern „DNA" (sic!) und „Dünnes
Eis“, bevor es mal grooviger oder auch ruhiger wird. Er thematisiert
Haltung und den Krieg und überzeugt auch sonst mit guten Texten.
Trotzdem: Erst ein Highlight wie „Atlantis“ zeigt aber,
dass er auch gerne etwas mehr experimentieren könnte. Ansonsten
darf man sich freuen, dass er wieder laut ist!
lässt
sich an dieser Stelle nahtlos weiterdenken. Denn auch Daniel Wirtz ist
ein Musiker, der sich seit seiner Wandlung vom (Englisch singenden)
Sub7even-Frontmann zum Solokünstler (mit deutschen Texten) zwar
immer wieder neue Themen sucht, variiert gerne seine Lautstärke und
Geschwindigkeit, hat mit seinen Unplugged Alben und Tourneen bewiesen,
dass seine Songs auch ohne Strom wunderbar funktionieren, aber bleibt
sich doch letztlich immer treu. Das gilt auch für sein neues
Album, das erste Studioalbum seit 7 (!) Jahren. Womit die Pause
länger war, als je zuvor, o.g. Tourneen und natürlich die
Pandemie haben ihren Teil dazu beigetragen. Vielleicht war es ihm
deswegen schon fast ein Anliegen, zu beweisen, dass er trotzdem noch
der Alte ist. Also rockt er zu fetten Gitarrenriffs und treibenden
Drums in den beiden Openern „DNA" (sic!) und „Dünnes
Eis“, bevor es mal grooviger oder auch ruhiger wird. Er thematisiert
Haltung und den Krieg und überzeugt auch sonst mit guten Texten.
Trotzdem: Erst ein Highlight wie „Atlantis“ zeigt aber,
dass er auch gerne etwas mehr experimentieren könnte. Ansonsten
darf man sich freuen, dass er wieder laut ist!
Für KW 5: Neal Morse - The Restoration – Joseph: Part Two –
(Frontiers Music)
 Zum
Geburtstag die alten Freunde einladen :-) Da passt dieses Album doch
allerbest! "Die Alben von Neal Morse berühren mich immer
weniger", erzählte mir neulich ein Freund. Kann passieren, geht
bestimmt auch anderen so. Aber woran liegt das? Denn eigentlich hat er
ja nichts geändert. Also ist genau das vielleicht der Hauptgrund?
Müssen sich Künstler weiterentwickeln um relevant zu bleiben?
Das muss wohl jeder für sich selbst und für jeden einzelnen
Künstler entscheiden. Tatsache ist, dass auch der zweite Teil
seines Joseph Musicals ein Album ist, dass man über Stunden auf
Repeat hören kann und sollte, weil man nur so immer tiefer
eindringt in die Story und in das Sounduniversum dieses Albums. Das ist
einmal mehr riesengroß und reicht von Spock´s
Beard-Satzgesang, Stakkatorhythmus-Frikkelprog über ganz ruhige
Passagen bis zu großen Bombastrock-Steigerungen. Also das
typische Morse-Repertoire, in typischer Qualität und mit maximaler
Abwechslung. Die zahlreichen Sänger_innen tragen genau dazu bei:
Neal Morse, Ted Leonard, Ross Jennings, Talon David um nur einige zu
nennen. Wer mehr braucht, hat sich vielleicht einfach noch nicht genug
Zeit genommen!
Zum
Geburtstag die alten Freunde einladen :-) Da passt dieses Album doch
allerbest! "Die Alben von Neal Morse berühren mich immer
weniger", erzählte mir neulich ein Freund. Kann passieren, geht
bestimmt auch anderen so. Aber woran liegt das? Denn eigentlich hat er
ja nichts geändert. Also ist genau das vielleicht der Hauptgrund?
Müssen sich Künstler weiterentwickeln um relevant zu bleiben?
Das muss wohl jeder für sich selbst und für jeden einzelnen
Künstler entscheiden. Tatsache ist, dass auch der zweite Teil
seines Joseph Musicals ein Album ist, dass man über Stunden auf
Repeat hören kann und sollte, weil man nur so immer tiefer
eindringt in die Story und in das Sounduniversum dieses Albums. Das ist
einmal mehr riesengroß und reicht von Spock´s
Beard-Satzgesang, Stakkatorhythmus-Frikkelprog über ganz ruhige
Passagen bis zu großen Bombastrock-Steigerungen. Also das
typische Morse-Repertoire, in typischer Qualität und mit maximaler
Abwechslung. Die zahlreichen Sänger_innen tragen genau dazu bei:
Neal Morse, Ted Leonard, Ross Jennings, Talon David um nur einige zu
nennen. Wer mehr braucht, hat sich vielleicht einfach noch nicht genug
Zeit genommen!
Für KW 4: Caligula`s Horse - Charcoal Grace (InsideOutMusic / Sony Music)
Sie sind die vierten im Bunde mit Haken, Teramaze und Soen. Auch
Caligula´s Horse haben bereits mehrfach bewiesen, dass sie die brillante Kunst beherrschen, ProgMetal mit soften Vocals und
herzzerreißenden Melodien zu einem wunderbaren Ganzen zu
verschmelzen und damit die Tore zu verschiedenen Genres weit
aufzureißen. Da macht auch das neue Album keine Ausnahme. Und
wäre es ihr erstes, wäre meine Rezension an dieser Stelle
noch viel überschwänglicher. So muss man konstatieren, dass
sie ein weiteres Mal tolle Songs und Melodien und Ideen abliefern, dass
die Überflieger Highlights, die man jedem ans Herz legen
möchte, aber nicht unbedingt dabei sind. Denn trotz mehrfachen
Hörens bleibt nicht ein einzelner Song beeindruckend, sondern eher
das Album als Ganzes. Anders ausgedrückt: willst du einen
Anspieltipp? Such dir einen Song aus, sie sind alle schlicht
großartig. Das beginnt mit dem 10-minütigen
Eröffnungsstatement „The World Breathes With Me”
über kürzere Songs zwischen 4 und 6 Minuten und dem
24-minütigen Zentrum des Albums, der vierteiligen Suite des
Titeltracks bis zum 12minütigen Abschluss „Mute“
– also, welche Länge passt dir am besten?
brillante Kunst beherrschen, ProgMetal mit soften Vocals und
herzzerreißenden Melodien zu einem wunderbaren Ganzen zu
verschmelzen und damit die Tore zu verschiedenen Genres weit
aufzureißen. Da macht auch das neue Album keine Ausnahme. Und
wäre es ihr erstes, wäre meine Rezension an dieser Stelle
noch viel überschwänglicher. So muss man konstatieren, dass
sie ein weiteres Mal tolle Songs und Melodien und Ideen abliefern, dass
die Überflieger Highlights, die man jedem ans Herz legen
möchte, aber nicht unbedingt dabei sind. Denn trotz mehrfachen
Hörens bleibt nicht ein einzelner Song beeindruckend, sondern eher
das Album als Ganzes. Anders ausgedrückt: willst du einen
Anspieltipp? Such dir einen Song aus, sie sind alle schlicht
großartig. Das beginnt mit dem 10-minütigen
Eröffnungsstatement „The World Breathes With Me”
über kürzere Songs zwischen 4 und 6 Minuten und dem
24-minütigen Zentrum des Albums, der vierteiligen Suite des
Titeltracks bis zum 12minütigen Abschluss „Mute“
– also, welche Länge passt dir am besten?
Für KW 3: SLIFT - ILION (Sub Pop Records / Cargo)
 Eine
der ersten Veröffentlichungen des Jahres, denen man sich nur sehr
schwer entziehen kann. Eigentlich haut sie dich spontan aus den Socken
und walzt dich einfach um. Vor allem letzteres Bild wird ja gerne
für diesen Dampfwalzensound des Postrock verwendet, wenn er mit
dieser Macht und dieser meterhohen Wall of Sound ertönt. In seiner
(Stoner Rock-)Härte mit seinen Metalgitarren und dem etwas
gröligen Gesang mag man zunächst noch etwas befremdet sein,
aber wenn du dich darauf einlässt, dann lässt er dich nur
schwer wieder los. Kaum zu glauben, dass diese Soundgewalt von einem
Trio, bestehend aus den Brüdern Jean and Remí Fossat und
Canek Flores aus Frankreich stammt. Das erinnert an …And You
Will Know Us By the Trail of Dead, in seinen melodischeren, bisweilen
auch psychedelischen Momenten auch an das monumentale letzte Werk von
Earthside. 2017 gab es eine erste EP, gefolgt von zwei Longplayern und
der zwischendurch auf youtube veröffentlichten KEXP Live Session,
die es auf mehr als 1,4 Millionen Klicks brachte. Sie haben also
mittlerweile ein gewisses Selbstverständnis entwickelt, das sie
jetzt in 80 Minuten Sound gegossen haben, verteilt auf 8 Songs, von
denen 3 die 10-Minuten-Marke hinter sich lassen und nur einer deutlich
unter 8 Minuten bleibt. Sehr gelungen!
Eine
der ersten Veröffentlichungen des Jahres, denen man sich nur sehr
schwer entziehen kann. Eigentlich haut sie dich spontan aus den Socken
und walzt dich einfach um. Vor allem letzteres Bild wird ja gerne
für diesen Dampfwalzensound des Postrock verwendet, wenn er mit
dieser Macht und dieser meterhohen Wall of Sound ertönt. In seiner
(Stoner Rock-)Härte mit seinen Metalgitarren und dem etwas
gröligen Gesang mag man zunächst noch etwas befremdet sein,
aber wenn du dich darauf einlässt, dann lässt er dich nur
schwer wieder los. Kaum zu glauben, dass diese Soundgewalt von einem
Trio, bestehend aus den Brüdern Jean and Remí Fossat und
Canek Flores aus Frankreich stammt. Das erinnert an …And You
Will Know Us By the Trail of Dead, in seinen melodischeren, bisweilen
auch psychedelischen Momenten auch an das monumentale letzte Werk von
Earthside. 2017 gab es eine erste EP, gefolgt von zwei Longplayern und
der zwischendurch auf youtube veröffentlichten KEXP Live Session,
die es auf mehr als 1,4 Millionen Klicks brachte. Sie haben also
mittlerweile ein gewisses Selbstverständnis entwickelt, das sie
jetzt in 80 Minuten Sound gegossen haben, verteilt auf 8 Songs, von
denen 3 die 10-Minuten-Marke hinter sich lassen und nur einer deutlich
unter 8 Minuten bleibt. Sehr gelungen!
Für KW 2: Giant Sky - Giant Sky II (GlassVille Records)
Erlend Viken ist Songwriter bei Soup, dieser norwegischen Mega-Band mit dem un-google-baren Namen. Mit Giant  Sky
hat er sich noch einen zweiten Output geschaffen, für den er sich
die Zusammenarbeit mit Musikern u.a. des Trondheim Symphonic Orchestra,
Combos, WZRD, und Motorpsycho gesichert hat. Während es
darüber hinaus wenig Infos über die Besetzung gibt, kann die
Musik auch für sich allein sprechen. Die Vergleichbarkeiten sind
offensichtlich, v.a. in den 5 Highlight-Songs des Albums (von 13), die
mit 35 Minuten schon allein die Hälfte ausmachen. Hier erweitert
Viken den Soup-Sound zwischen Long Distance Calling und Anathema aus
Art- und Post-Rock Versatzstücken gemischt mit
Archive-ähnlichen, ruhigen Momenten um Zutaten wie weiblichen
Gesang (der den männlichen bisweilen ergänzt),
Post-Rock-Steigerungen und instrumentale Zwischenspiele, die vereinzelt
Pink Floyd-Referenzen aufweisen. Daneben gibt es Songs zwischen
symphonischen und elektronischen („Speak Through Walls“),
Ambient („Space Farrier“) oder mystisch-psychedelischen
Elementen („The Present“), aber immer wieder holt er gerne
auch die PostRock-Wall-of-Sound-Keule raus. Ein sehr kurzweiliges,
abwechslungsreiches wie spannendes Album!
Sky
hat er sich noch einen zweiten Output geschaffen, für den er sich
die Zusammenarbeit mit Musikern u.a. des Trondheim Symphonic Orchestra,
Combos, WZRD, und Motorpsycho gesichert hat. Während es
darüber hinaus wenig Infos über die Besetzung gibt, kann die
Musik auch für sich allein sprechen. Die Vergleichbarkeiten sind
offensichtlich, v.a. in den 5 Highlight-Songs des Albums (von 13), die
mit 35 Minuten schon allein die Hälfte ausmachen. Hier erweitert
Viken den Soup-Sound zwischen Long Distance Calling und Anathema aus
Art- und Post-Rock Versatzstücken gemischt mit
Archive-ähnlichen, ruhigen Momenten um Zutaten wie weiblichen
Gesang (der den männlichen bisweilen ergänzt),
Post-Rock-Steigerungen und instrumentale Zwischenspiele, die vereinzelt
Pink Floyd-Referenzen aufweisen. Daneben gibt es Songs zwischen
symphonischen und elektronischen („Speak Through Walls“),
Ambient („Space Farrier“) oder mystisch-psychedelischen
Elementen („The Present“), aber immer wieder holt er gerne
auch die PostRock-Wall-of-Sound-Keule raus. Ein sehr kurzweiliges,
abwechslungsreiches wie spannendes Album!
Für KW 52_2 / KW 1: Dirt Buyer - Dirt Buyer II (Bayonet Records)
 Radiohead-Fans
aufgepasst: mit seinem neuen Album präsentiert sich Joe Sutkowski
mit bestem Referenzen zwischen Akustik, Indie und Emo-Rock. Das Album
lebt vom ständigen Wechselspiel aus mehr oder weniger entspannten,
akustisch-geprägten Phasen und elektrifizerten
Rockausbrüchen, mal mehr mal weniger eruptiv und dramatisch. Wie
Radiohead in ihren besten Indie-Rock-Momenten („Creep“).
Radiohead-Fans
aufgepasst: mit seinem neuen Album präsentiert sich Joe Sutkowski
mit bestem Referenzen zwischen Akustik, Indie und Emo-Rock. Das Album
lebt vom ständigen Wechselspiel aus mehr oder weniger entspannten,
akustisch-geprägten Phasen und elektrifizerten
Rockausbrüchen, mal mehr mal weniger eruptiv und dramatisch. Wie
Radiohead in ihren besten Indie-Rock-Momenten („Creep“).
Dabei definieren die ersten beiden Songs ihre Bandbreite: Der Opener
„Dirt Buyer II Theme“ entwickelt sich vom leisen Beginn
immer mehr zum Rockkracher inerhalb 3:17, der folgende
„Heavy“ (sic!) kommt in 1:12 auf den Punkt. Erst das
abschließende „On & On“ bringt es wieder (und mit
4:23 weit!) über die 3-Minuten-Grenze. Und dann ist nach 31
Minuten auch schon alles gesagt.